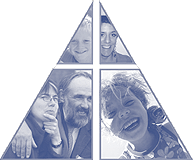Gode Pötter
Administrator

Anmeldedatum: 15.10.2006
Beiträge: 317
Wohnort (nur bei Vollmitgliedschaft erforderlich ): 45663 Recklinghausen
|
 Verfasst am: 07.06.2008, 10:38 Titel: Brich mit dem Hungrigen dein Brot Verfasst am: 07.06.2008, 10:38 Titel: Brich mit dem Hungrigen dein Brot |
 |
|
Brich mit dem Hungrigen dein Brot
Arm und Reich jenseits der Schamgrenze
Quelle: Franz Segbers in "Christen heute", Mai 2008
Wer weiß eigentlich heute noch, was ein „Schnorrer“ war? Ein Schnorrer war weder ein Bettler noch ein „Nassauer“, sondern eine sehr selbstbewusste Persönlichkeit in den jüdischen Gemeinden, die sich zugute hielt, dass sie den Reichen die Gelegenheit ermöglichte, Gerechtigkeit zu üben, was ihnen das Tor zum Paradies öffnete. Wehe, wenn sie streikten, weil die überreichte Geldspende nicht angemessen schien. Sie machten den Geiz eines solchen Reichen öffentlich, indem sie ihn boykottierten, ihn nicht mehr aufsuchten, um die Spende abzuholen. Er geriet dadurch in der jüdischen Gemeinde in Verruf und konnte sich nur durch Bitte um Entschuldigung bei den Schnorrern rehabilitieren, die sie ihm gnädig gewährten, wenn er Reue zeigte und tätige Buße übte.
Von einem Rothschild, Baron aus der berühmten Frankfurter Bankiersfamilie, wird berichtet, dass er einem Schnorrer durch seinen Sekretär mitteilen ließ, er müsse sich diesmal mit einem geringeren Betrag begnügen, da der Herr Baron wegen der Hochzeit seiner Tochter erhebliche Ausgaben hatte. Daraufhin der Schnorrer empört: „Was – mit meinem Geld will der Herr Baron seine Tochter verheiraten!“
Was macht die Geschichte so amüsant? Natürlich, die Dreistigkeit. Der Empfänger von milden Gaben wird auch noch frech! Er tritt mit Ansprüchen auf und pocht auf sein Recht. Und doch: In einer überdeutlichen Überzeichnung zeigt diese Geschichte den Grundgedanken des biblischen Umgangs mit Armut und Reichtum auf. Für die Bibel ist der Arme nicht Objekt der Barmherzigkeit, dem man sich zuwendet und aus seinem Überfluss barmherzig abgibt. Der Arme ist in der Bibel eine Person, die mit Rechten ausgestattet ist. Er ist nicht Bettler um milde Gaben, sondern jemand, der ein Recht darauf hat, dass die Gesellschaft ihm aus seiner Not und zu seinem Recht auf ein würdiges auskömmliches Leben verhilft. Bekannt sind die scharfen Attacken der Propheten auf die Reichen im Lande, die Reichen, die für ein Paar Sandalen die Armen verscherbeln, wie der Prophet Amos kritisiert. (Amos 2,6)
Nur zulange hat die Christenheit, zumal die Kirchen der Reformation, die prophetische Tradition allenfalls gelesen und gehört, wenn es um Armut und Gerechtigkeit geht. Übersehen wurde bis in unsere Tage, dass sich der prophetische Einspruch gegen Unrecht und Ungerechtigkeit in einem Sozialrecht niedergeschlagen hat. So kennt die Bibel eine Sozialhilfe für die Mittellosen (Deuteronomium 14, 28f.). In jedem dritten Jahr sollen die Reichen den Zehnten abliefern, damit die „Witwen, Waise und Fremde“ eine Unterstützung für ihren Lebensunterhalt bekommen. Weitere Elemente sind das Gebot, täglich den Lohn auszuzahlen, Schuldenerlass oder Kredithilfe. Die Überschrift über dieses Sozialrecht, das den Armen schützen soll, lautet: „Unter euch solle es eigentlich keine Armen geben.“ (Deuteronomium 15,4) Nun gibt es aber trotzdem Arme. Und Jesus sagt: „Arme habt ihr allzeit unter euch.“ Jesus zitiert hier das Alte Testament. Gerade weil die Menschen die Rechte der Armen nicht geachtet haben, deshalb gibt es Arme. Armut ist für die Bibel also weder eine Sache, mit der man sich abfinden soll, noch etwas, was es immer und überall gegeben hat. Armut ist vor allem eine Rechtsverletzung der Armen, wenn die Gesellschaft es unterlässt, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen.
Der Zusammenhang von Armut und Gerechtigkeit
Auch unsere reiche Gesellschaft unterlässt es, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen, wenn es mitten im Reichtum nicht nur Armut gibt, sondern sie auch noch zunimmt. Seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland ist Jahr für Jahr der Reichtum des Landes gewachsen. Auch die ärmeren Schichten der Gesellschaft hatten an dieser Entwicklung teil. Allen ging es immer besser. Die Soziologen nannten diese Entwicklung eine „Aufzugsgesellschaft“. Dieses Bild der Aufzugsgesellschaft, in der die Reichen zwar reicher werden, es den Ärmeren aber auch besser geht, wird der Wirklichkeit nicht mehr gerecht. Aus der Aufzugsgesellschaft ist eine Paternostergesellschaft geworden. Längst ist die ehedem sichere Mittelschicht von Armut betroffen. Kinder mit guter Ausbildung bekommen keine Jobs, hangeln sich von einem Praktikum zum nächsten, von einem Zeitvertrag zum nächsten. Längst reicht die Erfahrung, dass das Leben unsicher geworden ist, bis in unsere kirchlichen Mittelschichtsgemeinden hinein. Neuere Untersuchungen belegen, dass sich auch die Mittelschicht beginnt aufzulösen. 19 Prozent derer, die noch vor fünf Jahren zur Mittelschicht gehörten, sind jetzt in Armut geraten.
Der biblische Blick auf Armut und Reichtum
Die Geschichte lehrt: Der Herr Baron Rothschild steht in Verantwortung für die Lebenslage der Armen. Es liegt an ihm, den Armen zu seinem Recht kommen zu lassen.
Hier zeigt sich der Blick des biblischen Ethos. Der Blick auf das fremde Leid gehört zur Mitte des biblischen Erbes. Erbarmen ist nicht ein unpolitisches Mitleid, nicht Mildtätigkeit und Caritas. Erbarmen, wie es die Bibel versteht, entstammt einer Leidempfindlichkeit, ist ein Mit-Leiden, das die Not der anderen sieht. Mit-Leiden entsteht angesichts der realen Situation anderer unschuldig Leidender und aus Solidarität mit ihnen.
Der Blick auf das fremde Leid ist eine Grundtugend der Christen. Was die Bibel mit „Erbarmen“ benennt, nennen wir heute „Solidarität“. Diese Haltung hat einen Grund: Die Anerkennung der gleichen Würde aller Menschen. Das ist der Grund für die verlässliche Zuwendung zu denen, die am Rande der Gesellschaft stehen, von elementarer wirtschaftlicher Not betroffen sind oder nicht gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Fremdes Leid zu sehen und öffentlich zur Sprache zu bringen, ist Voraussetzung aller Formen von Solidarität angesichts des eskalierenden Risses zwischen Arm und Reich und auch aller sozialen Kultur.
Jesu und der Propheten erster Blick galt nicht der Sünde, nicht dem ewigen Leben, sondern der Witwe, dem Armen, dem Waisen, dem Fremden. In der Option für die Armen zeigt sich der Gott der Bibel, der in der Person des Jesus von Nazareth den Menschen nahe kommt, als ein Gott, der Partei nimmt für die Gedemütigten, die Leidenden, die Armen, Gedrückten und Entrechteten.
Was macht arm? Was macht reich?
Wer über Reichtum nicht reden will, der kann auch nicht darüber reden, wie Armut in diesem Land behoben werden kann. Nach einer neuen Untersuchung, die auch dem nächsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zu Grunde liegen wird, besitzen die oberen zwanzig Prozent der deutschen Haushalte etwas 88 Prozent des Vermögens, während die unteren dreißig Prozent überhaupt kein Vermögen besitzen. Der Skandal ist dabei, dass diese ungleiche Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums weiter voranschreitet. Die Armen verarmen und die Reichen werden reicher. Das heißt: Wer Armut bekämpfen will, der muss diese Missverhältnisse ändern.
Wenn Armut mehr und anderes ist als nur materielle Not, dann ist Reichtum auch mehr und anderes als viel Geld. Reichtum hat es mit Vermögen im wahrsten Sinn des Wortes zu tun. Wer reich ist, der vermag viel in dieser Gesellschaft. Sein Einfluss ist groß, seine Kinder haben eine größere Chance, Abitur zu machen und zu studieren. Wer reich ist, der lebt im Durchschnitt sieben Jahre länger als jemand, der arm ist.
Armut ist auch mehr als Einkommensarmut. Was Armut wirklich bedeutet, zeigt sich an Hartz IV. Vor seiner Einführung Ende 2004 lebten 2,6 Millionen Menschen auf Sozialhilfeniveau. Doch seit den Hartz-Reformen hat sich diese Zahl auf mehr als 7 Millionen gesteigert. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband (DPWV) konnte nachweisen, dass es bei der Neuberechnung der Regelsätze und der Festlegung der Arbeitslosengeldes II willkürlich zugegangen ist. Damit Sozialhilfe leisten kann, wofür sie da ist, fordert der DPWV eine Erhöhung um 19 Prozent. Wer Sozialhilfe, Hartz IV also, bezieht, der hat nach dem Willen der Bundesregierung gerade einmal für seine Lebensbedürfnisse folgende Ausgabenposten im Monat: Für Nahrung stehen ca. 130 Euro, für Kleidung 32 Euro, für Post 27 Euro und für Verkehr 26 Euro oder die Bewirtung von Gästen 10 Euro zur Verfügung. Und für Bildung 0 Euro!
Noch im Juli letzten Jahres hat die Bundesregierung erklärt, dass die Regelleistung das soziokulturelle Existenzminimum abbildet und auch die nötigen Ausgaben für die Nutzung von Verkehrsmitteln und Nahrungsmittel sowie Schulbedarf umfasst. Wenn die Bundesregierung einen Regelsatz als ausreichend erklärt, der Kindern bis zu einem Alter von 14 Jahren 2,28 Euro täglich für Lebensmittel zugesteht, dann haben wir es mit Mangelernährung zu tun. Hartz IV bedeutet für Kinder monatlich: 3,60 Euro etwa für Schuhe, 13,88 Euro für Kleidung, 1,41 Euro für Spielzeug und 1,33 Euro für Schulhefte, 1,26 Euro für Zoo- und Kinobesuche. Jetzt hat die Bundesregierung beschlossen, das Kindergeld zu erhöhen; ca. vier Euro wird dies für jedes Kind ausmachen, nicht aber für die Kinder, deren Eltern Hartz IV beziehen. Sie bekommen nicht einen Cent mehr, wenn das Kindergeld erhöht wird. Bei ihnen nämlich wird das Kindergeld vom Regelsatz abgezogen. Es wird bei den Armen gespart. Nach einer neuen Untersuchung wurden für SGB II- und SBG III-Leistungen, also für Hartz IV, im Haushaltsjahr 2007 von der Bundesanstalt für Arbeit, dem Bund und den Kommunen etwa 10,2 Mrd. Euro weniger als im Haushaltsjahr 2006 ausgegeben.
Was ist Armut?
Es gibt keine wissenschaftlich-objektive Definition. Armut ist das, worauf wir uns verständigen, was Armut ist: Je nachdem, wie viel oder wie wenig wir als Gesellschaft bereit sind, von dem insgesamt erwirtschafteten Wohlstand für die Verhinderung oder Behebung von Notlagen in der Bevölkerung abzuzweigen, werden wir bei der inhaltlichen Festlegung des Begriffs Armut die Grenzen weiter oder enger abstecken. Die Landesbanken haben in den letzten Monaten Abermilliarden an Hypothekenkrediten von US-Banken übernommen. Alleine die IKB-Bank ist in diesem Zusammenhang nun schon mit 9 Milliarden Euro gestützt worden (davon waren der größte Teil die öffentlichen Mittel der KfW!), um die Abschreibungen von US-Hypothekenkrediten zu verkraften. Wir haben also volkswirtschaftliche Handlungsspielräume, um damit gesellschaftliche Anliegen zu verwirklichen, die uns wichtig sind! Wir könnten es uns leisten, jenen Mitbürgern Barmherzigkeit und Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die in Armut geraten sind.
Armut ist gemacht. Von wem? Nicht von den Armen, auch wenn ihnen die Verantwortung für ihre Lage in der Regel aufgehalst wird. Einkommensarmut ist das eine Ende einer Skala der Verteilung von Einkommen und Vermögen, dessen anderes Ende durch Reichtum gebildet wird. Was sind die Ursachen von Armut, Not und Mangelernährung? Es fehlt nicht an Barmherzigkeit, nicht am Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, von Kirchengemeinden, die Tafeln anbieten oder Suppenküchen. Es fehlt an Gerechtigkeit in unserem Land.
Armut hat politische Ursachen.
Welche sind es?
1. NiedriglohnsektorDie Hartz IV-Reformen zwingen Menschen auf Arbeitsmärkte, um dort Arbeit aufzunehmen – zu jedem Preis und um jeden Preis, dabei wird der Hartz IV-Regelsatz bewusst so niedrig gehalten, dass man mit ihm kein menschenwürdiges Leben bestreiten kann. Die Arbeitslosenzahlen sinken und die Zahl der Menschen, die auf ALG II angewiesen sind, steigt. Dabei zeigt sich ein Trend: Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte, die ALG II beziehen, ist um 17 Prozent gesunken, während es bei den Haushalten mit drei und mehr Mitgliedern deutliche Steigerungsraten zu verzeichnen gibt. Was bedeutet das? Die Löhne für eine Vollzeitbeschäftigung reichen in der Regel nicht aus, um von Hartz IV unabhängig zu werden. Deshalb sind sie darauf angewiesen, ihren niedrigen Lohn aufzustocken. So ist die Zahl der sogenannten Aufstocker in den letzten Jahren stetig gestiegen auf über 1,2 Millionen. Der politisch gewollte Ausbau des Niedriglohnsektors hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen arm sind trotz Arbeit. Sie müssen also zusätzlich zur niedrig entlohnten Arbeit noch Sozialleistungen beziehen. Die Unternehmen senken die Löhne und die Gesellschaft muss über Steuern aufstocken.
2. LohnsenkungDeutschland ist das einzige Land im Euroraum, in dem die Lohnskosten seit Jahren kontinuierlich zurückgehen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung nennt diese einen „Präzedenzfall“. Das Realeinkommen wurde gesenkt, die Arbeit unsicherer, Leiharbeit nimmt zu, während gleichzeitig die Gewinne der Unternehmen wachsen.
3. Kein MindestlohnIn 20 der 27 EU-Länder gibt es gesetzliche Mindestlöhne – nur in Deutschland nicht. Kein Wunder, dass Deutschland den größten Niedriglohnsektor in der EU mit 8-9 Millionen Beschäftigten hat, darunter 3-4 Millionen in Vollzeit. Der Anteil an allen Beschäftigten liegt mit gut 18 Prozent deutlich über den europäischen Durchschnitt.
4. Steuersenkungspolitik mit Folge öffentliche Armut Während Deutschland so reich ist wie nie zuvor, befindet sich die Steuerquote im Sinkflug. Die steuerpolitische Maßnahmen der letzten Jahre haben dazu beigetragen, dass das Steueraufkommen sich drastisch reduziert hat. Würde derzeit eine Steuerquote wie im Jahr 2000 gelten, so würde die öffentliche Hand über 65 Milliarden Euro Mehreinnahmen erzielen. Gäbe es gar eine Steuer- und Abgabenquote wie in Skandinavien, dann würde die öffentliche Hand Mehreinnahmen in der Höhe ca. 130 Milliarden verbuchen. Kein Wunder, dass in den skandinavischen Ländern das Phänomen der Kinderarmut unbekannt ist und diese Länder auch Spitzenreiter in der Bildung sind. Der gesellschaftliche Reichtum ist in den letzten Jahren entlastet worden und wird nicht mehr zum Wohlstand eines Gemeinwesen herangezogen, wie es nötig wäre.
Privater Reichtum muss sich wieder für die Wohlfahrt aller nützlich machen. Wer hier von einer „Neiddebatte" redet, der verkennt diesen vitalen Zusammenhang von Steueraufkommen und der Erzeugung oder Vermeidung öffentlicher und privater Armut.
Der reiche Baron Rothschild ist ein Mann, wie die Bibel sich einen Reichen vorstellt. Er wird gefordert, seine Verantwortung wahrzunehmen. Er soll nicht von seinem Überfluss in Barmherzigkeit abgeben, sondern den Rechtsanspruch des Armen, des „Schnorrers“ einlösen. Er wird nicht moralisch angeklagt wegen seines Reichtums oder um eine doch bitteschön angemessene großherzige Spende gebeten. Er kommt aber in einen Konflikt mit dem Schnorrer, wenn er seiner ethischen Verantwortung zu teilen nicht nachkommt. Erbarmen nimmt in der biblischen Tradition die Gestalt von Recht an – wie der Schnorrer. Rothschild wird in die Pflicht genommen, mit „dem Hungrigen sein Brot zu brechen“ (Jes 58,7). Diese Verpflichtung, das Brot zu brechen, ist keine Mahnung ans Gewissen, sondern eine rechtliche Verpflichtung.
Franz Segbers |
|