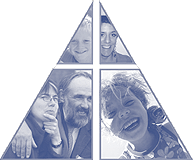André Golob

Anmeldedatum: 21.10.2006
Beiträge: 129
Wohnort (nur bei Vollmitgliedschaft erforderlich ): 46236 Bottrop
|
 Verfasst am: 21.10.2006, 17:27 Titel: Joh 2, 13-25 Die „Tempelreinigung“ als Bild psychische und s Verfasst am: 21.10.2006, 17:27 Titel: Joh 2, 13-25 Die „Tempelreinigung“ als Bild psychische und s |
 |
|
19.03.06 Predigt zu Joh 3,12-25
Eucharistiefeier am 3. Fastensonntag im Jahreskreis B
Alt-kath. Gemeinde Düsseldorf
Klarenbachkapelle, Düsseldorf-Reisholz, 22.03.2006, 10.30 Uhr
Leitung und Predigt: Vikar Dr. André Golob
___________________________________________________________________
Joh 2, 13-25 Die „Tempelreinigung“ als Bild psychischer und sozialer Hygiene
Ein Dogma unserer Religion lautet: Christus wahrer Mensch und wahrer Gott. Heute haben wir eine Szene aus dem Johannesevangelium miterlebt, wo wir vor allem ersteres bestätigt sehen. Jesus rastet aus, Jesus ist empört und tobt, er ergreift sogar eine Peitsche, eine Geißel, und prügelt auf die Hausierer und Händler ein, schmeißt ihre Läden, ihre Tische um und treibt sie fort. Er spricht manchem von uns aus dem Herzen.
Aber was treibt Jesus, diesen warmherzigen Menschen, dazu so auszuticken, sich so vehement Luft zu verschaffen?
Jesus ereifert sich um des Tempels willen. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß der Tempel nicht irgendein heiliger Ort ist, an dem man sich möglichst taktvoll zu benehmen hat. Nein, der Tempel galt als Ort der Begegnung mit Gott. Hier begibt sich Gott unter die Menschen um nahe bei ihnen zu sein, um unter ihnen zu wohnen. Die Heiligkeit und Besonderheit dieses Ortes wird aber nicht mehr sichtbar, wenn hier geschäftiges Treiben, Geldzählen und Schachern stattfindet, wenn der Tempel benutzt wird als Basar als Markthalle. Wie Gott noch begegnen, ihn hören könne, wenn Händler sich ins Gebet einmischen? „Eine kleine Opfergabe gefällig, kostet nur 2 Talente und geht im Stehen.“
Übertragen wir diese Perikope in die heutige Zeit. Welchen Rat gibt sie uns?. Es gibt mehrere Ansätze, mehrere Perspektiven Bibelstellen zu interpretieren, zu verstehen, Weisheit und Nutzen aus ihnen zu ziehen. Ich möchte heute zwei von ihnen zu Rate ziehen. Beginnen wir mit der, nennen wir sie einmal sozialethischen oder sozialpolitische Perspektive.
Der Tempel in Jerusalem besteht nicht mehr. Vor vielen Zeiten wurde er von den Feinden der Juden niedergerissen. Zum Ort des Gebets, zum Ort der Begegnung mit Gott, der Ort für Theologie, für die Rede zu Gott, ist die Welt geworden. In der Welt begegnen wir Gott, erkennen ihn in den Augen unserer Mitmenschen. In der Welt erweisen wir Gott unsere Treue und Liebe. Jesus lehrt uns: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lasse die Welt zu einem Tempel werden, gestalte ihn für deinen Nächsten liebevoll und voll Mitgefühl. Die Welt wird zu einem Ort der Sorge um den Mitmenschen. Dies ist – so hat uns Christus gezeigt – tatsächlich Gottesdienst. Dieser Gottesdienst am Menschen hat für uns Christen im Mittelpunkt unseres Lebens zu stehen.
Religionsstatistiken berichten daß Milliarden Menschen sich als Christen bezeichnen, sich zur Lehre Christi, zur frohen Botschaft bekennen. Das Christentum ist die größte Religion der Welt. Millionen Menschen zahlen Kirchensteuern, lesen in der Bibel, können klar sehen welche Prioritäten Jesus setzte, an welchen Stellen er nicht kompromißbereit war. Sollte es dann nicht in unserem christlichem Abendland anders aussehen als es aussieht – vielleicht etwas christlicher? Warum gibt es noch soviel Arme, warum hungern in der dritten Welt Menschen, warum führen christliche Nationen Krieg. Ich werde es euch sagen – und damit stehen wir wieder mitten im Tempel, mitten im Geschehen des heutigen Evangeliums: Der Großteil dieses Übels erwächst aus der Gier nach Geld, nach Materiellem. Die Dollarzeichen in den Augen verrät man Volk und Vaterland, legt man alle Ideale nieder. „Money makes the World go round”, singt Liza Minelli im Musical “Cabaret”. Geld beherrscht die Welt. Wer reich ist hat Macht, bestimmt die Spielregeln, herrscht über die anderen.
Doch damit bricht die Sozialordnung Gottes in sich zusammen. Das Recht des Stärkeren, die Herrschaft der Reichen und Mächtigen, der sogenannte Sozialdarwinismus mag manchem als natürlich erscheinen. Doch göttlich ist er nicht, weil er unmenschlich ist. Ganz im Gegenteil: Gott übergab – davon berichtet das Alte Testament - seinem Volk Israel sensationelle Instrumente der Sozialpolitik z.B. das Zinsverbot, oder das Gebot bei der Ernte etwas für die Armen auf dem Acker liegen zu lassen, keine Waisen und Witwen zu unterdrücken, oder ganz bedeutsam: das Sabbatjahr. Alle sieben Jahre mußten in Israel den Schuldner die Schulden erlassen werden, wurde die Verteilung des Ackerlandes neu verlost, wieder Gleichstand hergestellt. Danach konnte das Monopoly neu beginnen, aber nach sieben Jahren erhielt der Verarmte zurück, was er an den Reichen verloren hatte. Gewiß: eine Lösung die den Einzelnen nicht zu Höchstleistungen anspornte und darum würde, wer heute das Sabbatjahr neu einführen wollte, zwar nicht gesteinigt, so doch ins Irrenhaus geschoben. Nur: Es gab in Israel vermutlich weniger Unglückliche als bei uns, wo nur die ersten Sieger wirklich glücklich sind, und auch diese nur so lange, bis sie von neuen Siegern vom Podest gestoßen werde. Wir müssen uns wieder öffnen für soziale Gedanken, wir müssen kritisch dem Materialismus und Kapitalismus begegnen. Christsein heißt auch politisch zu sein, sich einzusetzen für die, die unter die Räder einer Ökonomie kommen, die der Gewinnoptimierung und Rationalisierung zum Opfer fallen. Und wir müssen uns einsetzen für die, die nur noch Augen haben für materielle Dinge, Luxus, Wohlstand. Beide sind Opfer, auch die letzteren, auch die, die an den Machthebeln stehen.
Was ist das für ein Mensche, der voll Gier ist, der haben will, der haben muß, um von seine Schwächen abzulenken, der meint er gelte nur etwas, wenn er reich und erfolgreich sei? Ist er nicht bemitleidenswert?
Auch der Mensch kann ein Tempel Gottes sein. Mystiker berichten davon, daß Gott sich in uns ergießen kann, erleben, das Gott sie ausfüllt - ganz und gar. Doch wie soll man etwas in ein Gefäß gießen, wenn das Gefäß bereits bis zum Rand gefüllt ist mit Unrat. Die Geschichte von der Reinigung des Tempels hält uns den Spiegel vor. Wir sollen den Besen in die Hand nehmen, die Peitsche ergreifen und heraustreiben aus unserem Innern, was uns beherrscht und kaputt macht, das was Gott verdrängt und ihn ersetzt durch ein goldenes Kalb. Es ist Fastenzeit, Zeit der Besinnung, Zeit wo man Einkehr hält, losläßt, was hinderlich und unnatürlich ist, eine Zeit in der man aus sich einen Tempel des Herrn machen kann. Wäre es nicht schön frei zu sein, alle Ängste, Zwänge und Komplexe loszuwerden die uns dazu zwingen im Materiellen unser Heil zu suchen. Wäre es nicht schön statt Leid zu vermeiden, glücklich zu werden – statt zu haben zu sein?
Gerade für den Evangelisten Johannes findet der grandiose Kampf zwischen Gut und Böse im Inneren des Menschen statt. Dort entscheidet sich das Schicksal der Menschen. Wir müssen bei uns anfangen, lernen uns selbst zu lieben, mit der Hygiene bei uns selbst zu beginnen. Wenn uns das gelingt, dann sind wir auch fähig die anderen zu lieben. Erst dann können wir die Welt zu einem sozialen Gebilde gestalten. Nicht Sozialneid, der oft so sehr in sozialistischen Ideologien durchschimmert, soll unser Verhalten prägen, sondern die Liebe zum Menschen und die Erkenntnis in die Sozialordnung Gottes. Da müssen wir auch manchmal laut werden, da dürfen wir auch manchmal toben wie Jesus, wenn andere den Blick verlieren für die Wahrheit, wenn andere aus unserer Welt und unsere Seele einen Tempel des Mammons, der Belanglosigkeit und des Banalen machen wollen. Und müssen wir auch uns selbst und manchmal auch unsere eigene Kirche zurechtweisen, zeigen daß zum Christsein auch dazu gehört „Nein“ zu sagen – vielleicht auch ein mutiges Nein zu Hart IV z.B.. Manch Seelsorger erlebt vor Ort die Geburt der neuen Armut im Land. Dem muß man einen Riegel vorschieben. Was ist das für eine Gesellschaft in der die Aktienkurse eines Unternehmens ins Unermeßliche steigen, wenn es ankündigt Zehntausende von Arbeitsplätzen zu vernichten.
Die Welt, die wir gestalten und in der wir leben ist immer ein Spiegelbild unseres Innern.
Es gibt weise Lehrer, die gehen sogar noch weiter in der Interpretation der Tempelreinigung – wie z.B. der Mystiker Meister Eckehart. Es reicht ihm nicht, das materielle Denken auszulöschen. Auch reicht nicht der Sieg über die Angst, der Sieg über Minderwertigkeitsgefühle, die uns materielle denken lassen - die Sünde in uns gebären. Eckehart geht noch weiter. Für ihn ist die Seele des Menschen der wahre Tempel Gottes. Wahre Gottergebenheit heißt für ihn alle Begierden loszuwerden, sogar die Begierde gut oder gottgefällig zu sein, weil auch darin etwas egoistisches, Raum füllendes steckt.
Es ist eine besondere Botschaft für die Fastenzeit: Leer zu werden für Gott, alles aus unserer Seele zu verbannen, was unnütz Platz einnimmt, es Christus gleich zu tun.
Eine Menge kann uns das heutige Evangelium sagen. Doch alle Interpretationsansätze weisen denn auf eine Tatsache hin: Als Christen sehen wir uns der göttlichen Utopie verpflichtet, denn wir glauben an einen Gott, der Israel befreit hat aus der Knechtschaft und wir glauben an einen Gott der seinen Sohn nicht im Dunkel des Todes beließ, sondern ihn wach rief zum ewigen Leben. Aus dieser Sicht müssen wir unsere Welt gestalten, die Dunkelheit und Belanglosigkeit aus unserer Welt hinaustreiben.
Amen
(C) 2005 - Alle Rechte vorbehalten |
|