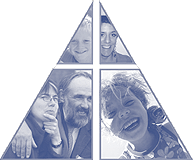| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
André Golob

Anmeldedatum: 21.10.2006
Beiträge: 129
Wohnort (nur bei Vollmitgliedschaft erforderlich ): 46236 Bottrop
|
 Verfasst am: 04.09.2007, 21:46 Titel: Religionen der Welt - Teil 7: Parsismus, Mazdaismus Verfasst am: 04.09.2007, 21:46 Titel: Religionen der Welt - Teil 7: Parsismus, Mazdaismus |
 |
|
Wir möchten an dieser Stelle eine Reihe starten mit dem Titel: „Über den Tellerrand geschaut – Religionen der Welt“ Es sollen hier zunächst weniger bekannte oder verbreitete Religionen und Kulturen vorgestellt werden. Denn wer kennt schon den Jainismus, den Taoismus, den Shintoismus oder so etwas wie Macumba. Darstellungen zu den bekannten Hochreligionen wie Buddhismus oder Islam werden diesen folgen. Um der Reihe eine gewisse Spannung zu verleihen, werden die einzelnen Religionen zunächst als Rätsel präsentiert. Wer errät als erster den Namen der gesuchten Religion?
Wir suchen heute ...
Mit Nietzsche hat diese Religion nicht viel gemeinsam. Dennoch verwendet Nietzsche im Titel eines seiner Hauptwerke den Namen des Schöpfers dieser Religion. Es gibt für diese Religion drei gängige Bezeichnungen. Die eine bezieht sich auf den gräzisierten Namen ihres Religionsschöpfers, die zweite auf den guten Gott dieser Religion, die dritte und aktuelle Bezeichnung für diese Religion leitet sich von ihrer geographische Herkunft ab. Gesucht sind alle drei Bezeichnungen! Ein bekannter Vertreter dieser persischen Religion, die so etwas wie Konversion oder Beitritt nicht kennt, ist der Dirigent und Musiker Zetha.
Zuletzt bearbeitet von André Golob am 04.09.2007, 21:49, insgesamt einmal bearbeitet |
|
| Nach oben |
|
 |
André Golob

Anmeldedatum: 21.10.2006
Beiträge: 129
Wohnort (nur bei Vollmitgliedschaft erforderlich ): 46236 Bottrop
|
 Verfasst am: 04.09.2007, 21:48 Titel: Verfasst am: 04.09.2007, 21:48 Titel: |
 |
|
Parsismus
Mazdāismus
Zoroastrianismus
Drei Namen für eine Religion
Der Name Parsismus, die heute allgemein übliche Bezeichnung der auf die Verkündigung des iranischen Priesterpropheten Zarathustra zurückgehende Religion, verweist auf deren Herkunft aus dem persischen Bereich. Er ist abgeleitet von dem alten Namen der persischen Landschaft Parsa, die jetzt Fars heißt. Eine zweite Benennung der Religion Zarathustras ist Zoroastrianismus; sie geht zurück auf die griechische Namensform ihres Stifters Zoroaster. Mitunter findet sich auch die Bezeichnung Mazdāismus die auf das Bekenntnis zum Gott Ahura Mazdā verweist.
Zarathustra ist wiederum die lateinische Form des iranischen Namens Zarathushtra. Seine Bedeutung ist: Einer, dessen Kamele (ushtra) zarath sind. Die Bedeutung des Wortes zarath ist unklar; von etymologischer Seite wird auf den möglichen Sinn „alt“ oder „gelb“ hingewiesen. Bekannt ist der Name Zarathustra durch Nietzsches Werk „Also sprach Zarathustra“. Inhaltlich gibt es jedoch nicht die geringste Nähe zum Nihilismus. Manchem ist der Name auch in der verballhornten Version des Zauberers Sarastro in Mozarts „Zauberflöte“ begegnet.
Ein beispielloses Jahrhundert
Geboren ist Zarathustra wohl am 22. März 603 (sehr wahrscheinlich in Afghanistan) und somit wirft die Lehre des iranischen Propheten ihren Schein in ein einzigartiges Jahrhundert. Diesem sechsten Jahrhundert gehörten auch die jüdischen Propheten Jeremia, Ezechiel, Daniel sowie der andere Jesaja, die chinesischen Weisheitslehrer Kung-Fu-Tse (Konfuzius) und Lao-tse und nicht zuletzt der indische Religionsstifter Siddharta Gautamo Buddha an.
Vom Polytheismus zum Monotheismus
Authentisches Material findet sich über Zarathustra, der als die bedeutendste Persönlichkeit des alten Iran bezeichnet werden kann, in den heiligen Schriften, den Gāthās des Avesta (vedisch-indische Sprache und heilige Schrift), die zum Teil auf ihn selbst zurückgehen. Ursprünglich war Zarathustra, der sehr wahrscheinlich einer vornehmen Familie von Pferdezüchtern entstammte, Priester der alten iranischen Religion, und zwar Sängerpriester (vifra), also Priester, Hymnensänger und sakraler Dichter. Im Zentrum des Kultes standen Opferungen für die herausragenden Götter und Göttinnen. Der Mithra-Dienst z.B. war geprägt von blutigen, orgiastischen Tieropfern (Stiere, Schafe, Ziegen) und dem Genuß eines starken Rauschtrankes (haoma). In einem ekstatischen Berufungserlebnis offenbarte sich Zarathustra der Gott Ahura Mazdā (der weise Herr), den er als absolut erlebt. Fortan verkündete er die Existenz eines einzigen, allmächtigen, unsichtbaren guten Gottes und versteht sein Streben als antipolytheistisch. Ahura Mazdā, der Gott des Lichts und der Weisheit wird durch Flammen symbolisiert. Noch heute brennt in den Parsentempeln - den sogenannten Feuertempeln - ein Feuer (ātar), das von Priestern, die aus Furcht vor der Verunreinigung des Feuers einen Mundschutz tragen, dauerhaft unterhalten wird. Zarathustra schließt die polytheistischen Götter seiner Heimat von der religiösen Verehrung gänzlich aus, so den kriegerischen Windgott Vayu, Mithra, den Herrn der Verträge und der staatlichen Ordnung und Herrschergewalt, den Verethraghna, der dem Indra der Inder entspricht, die Anāhitā, die Göttin der Fruchtbarkeit und zugleich die numinose Herrin der Gewässer, der der Biber heilig ist.
Der Dualismus und die Freiheit der Entscheidung
Ihnen setzt Zarathustra das alleinige Bekenntnis zu Ahura Mazdā entgegen. Dennoch erreicht dieses Bekenntnis nicht die absolute Exklusivität des mosaischen Monotheismus. Denn für Zarathustra ist das ganze Dasein durch einen unversöhnlichen Gegensatz gekennzeichnet, der ethischer Natur ist und im Transzendenten begründet liegt. Denn dem guten Gott Ahura Mazdā steht die Verkörperung des bösen Prinzips gegenüber, der Widersacher Angra Mainyu (der böse Geist). Entsprechend sind alle Phänomene und Geschehen in dieser Welt auf zwei Urprinzipien zurückzuführen: das Heilige, Tugendhafte (asha), woraus die guten Gedanken und Taten (vohu manah) entstehen, und das Feindselige, Abträgliche (drug (sprachwissenschaftlich mit „Trug“ bzw. „Drogen“ verwandt), woraus mißgünstige Gedanken und böse Taten (aka manah) entspringen. Zarathustras Dogma von der Unvereinbarkeit zweier numinoser Mächte bildete die Grundlage seiner ethischen Forderungen. Unerbittlich stellte Zarathustra die ethische Foderung eines Entweder – Oder. Dem Menschen maß der Prophet ein entscheidende Bedeutung in dem universalen Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen zu. Zarathustra setzt den freien Willen des Menschen voraus, wenn dieser in einer „rechten Wahl“, die grundsätzlich ist und offenbar eine nur einmalige Entscheidung bedeutet, in „Gedanken, Worten und Taten“ sittliches Handeln verwirklichen soll. Dazu zählt für Zarathustra auch die Abschaffung des Tieropfers und seiner orgiastischen Kulte sowie die Verdammung des zeremoniellen Rauschtrankes. Als irdisches Ziel seiner ethischen Gebote schwebt Zarathustra die Vorstellung eines „weidereichen, schönen Wohnens“ in einer friedlichen Welt vor, in der die „Erkenntnis des guten Sinnes“ sich eingefunden hat. (Yasna 48, 11 (das heilige Buch der Parsen, in dem auch die Gāthās enthalten sind)).
Eschatologische Dimensionen
In den Gāthās finden sich nicht nur individual-, sondern auch universal-eschatologische Aussagen. Auf Geheiß Ahura Mazdās findet ein endzeitliches Gericht statt, das mittels eines Ordals vollzogen wird. Durch Feuer und geschmolzenes Metall werden die Frommen von den Gottlosen getrennt. Der Zustand der geläuterten Erde, die aus diesem Gericht hervorgeht, wird in den Gāthās mehrfach als frasha „wunderbar“, bezeichnet. Später wir der Terminus frashōkereti üblich. Dieses Wort kann als „Verklärung, Wunderbarmachung“ verstanden werden.
Der Zervanismus
Der Dualismus in der Verkündigung Zarathustras erfuhr in der späteren Entwicklung eine entscheidende Einschränkung durch die theologische Spekulation des Zervanismus. Der Name dieser Lehre leitet sich ab von zervan akarana her, von der „unerschaffenen Zeit“. Der dualistische Gegensatz zwischen den beiden Geistern des Guten und des Bösen wird im Zervanismus überbrückt durch die Annahme einer Priorität der unerschaffenen Zeit, die als gemeinsamer Ursprung sowohl Ahura Mazdās (heute: Ōhrmazd) als auch Angra Mainyus (heute: Ahriman) erklärt wird.
Der Erretter
Mit der Zeit ist zu der ursprünglichen Lehre noch die Erwartung eines Erretters hinzugetreten, der zum Jüngsten Gericht erscheinen soll. Das Erscheinen des Saoshyant, der auf wundersame Weise aus dem Samen Zarathustras entsteht, wird 3.000 Jahre nach Zarathustra erwartet.
Luftbestattung und Gemeinde
Die vier Elemente (Feuer, Wasser, Erde und Luft) sind den Parsen heilig und dürfen nicht verunreinigt werden. Die Toten werden deshalb auf Roste in die Türme des Schweigens (dachmas) gelegt und von den Vögeln verzehrt (Luftbestattung). Ihre gebleichten Gebeine werden später gesammelt, um bis zum Tage des Gerichts verwahrt zu bleiben. Am bekanntesten sind die „Türme des Schweigens“ in Bombay. Dort lebt auch die größte Parsengemeinde Indiens (ca. 80.000). Bereits im Jahr 642 n.Chr. wanderten ein Großteil der Parsen auf der Flucht vor der muslimischen Invasion ins nordwestliche Indien aus, wo sie heute noch leben. Die Parsen zählen heute, wie die Sikhs, zu den wohlhabenden Indern, besitzen überdurchschnittliche Macht im Wirtschaftsleben und sind bekannt für ihre sozialen Aktivitäten. Ihre Zahl ist rückläufig, da Parsen nur untereinander heiraten dürfen. Kinder aus Mischehen gelten nicht als Parsen. Der Parsismus ist gemessen an der Zahl seiner Anhänger eine vergleichbar kleine Religion. Dennoch haben wir es bei den Anhängern der Lehre des Zarathustras mit einer über die ganze Welt verbreiteten Religion zu tun. Ihre Gläubigen sind z.B. in den USA und Kanada in maßgeblich gesellschaftlichen Positionen anzutreffen.
Liturgische Feste und Zeiten
Die Parsen feiern im Frühjahr ihr Neujahrsfest (jamshedi noruz). Bei dem Familienfest dienen Eier und immergrüne Pflanzen als Symbol des Lebens, des Fortbestehens und der Ewigkeit. Ebenso widmen sie Gottesdienste dem Geburtstag (khordad sal) und dem Todestag (zarsht-no-diso) des Propheten Zarathustra. Die letzten zehn Tage (farvadigan) ihres Kalenders (fasli) widmen die Parsen dem Gedenken an die Seelen der Verstorbenen, die in Gottesdiensten begrüßt und unterhalten werden. Die fünf Gāthās, Hymnen, deren Komposition auf Zarathustra selbst zurückgeht, werden an den letzten fünf Tagen dieser Zeit, den „Gāthā-Tagen“ rezitiert. Es entspricht dem Ziel äußerster Reinheit, daß das Feuer als Garant und Gegenstand der Meditation sowie als einzige erlaubte Ikone damaliger Zeit in den Riten dieser Religion einen hohen Rang einnimmt. Reinheit ist aber auch für ein anderes Ritual maßgeblich, das Zarathustra offenbar aus Indien übernommen hat: die Verleihung eines gewebten Bandes aus reiner Wolle, das als Zeichen der Initiation dreimal um die Hüfte geschlungen und vorn und hinten verknotet wird. Während bei den Brahmanen in Indien nur die Männer ein solches Band über einer Schulter tragen dürfen, führte Zarathustra den Brauch für beide Geschlechter ein.
André Golob |
|
| Nach oben |
|
 |
|
|
Sie können keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Sie können auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Sie können an Umfragen in diesem Forum nicht teilnehmen.
|

443 Angriffe abgewehrt
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Deutsche Übersetzung von phpBB.de |