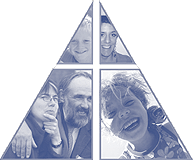redlabour
Gast
|
 Verfasst am: 07.02.2008, 13:08 Titel: Religionen der Welt - Teil 10: Der Islam Verfasst am: 07.02.2008, 13:08 Titel: Religionen der Welt - Teil 10: Der Islam |
 |
|
Sie dürfen diese Artikel frei kopieren unter Angabe der Herkunft: www.orientdienst.de
Inhaltsverzeichnis der Minikurse nach Themen
1. Glaubensgrundsätze des Islam
Auferweckung der Toten nach dem Koran
Bibel: Der Glaube an die Bücher
Bireligiöse Ehen Mohammeds
Engel – Dschinn
Gericht Gottes: Die Vorzeichen des Endgerichts im Islam
Heiliger Geist im Islam
Koran, seine Entstehungsgeschichte und Überlieferung
Mohammed – ein echter Prophet?
Mohammeds Leben
Mohammed und seine Feinde
Quellen des Koran
Paradieserwartung im Islam
Prädestination und freier Wille im Islam
Propheten
Tauhid – der eine Gott
Vergibt Allah? – „Vergebung“ im Koran
2. Pflichten des Islam
Anbetung im Islam
Bekenntnis-Schahada
Fasten
Gebet im Islam
Hadsch – die muslimische Pilgerreise nach Mekka
Islamisierung
Mission: Da`wah - Der Ruf zum Islam
Zakat - Sozialabgaben
3. Geschichte des Islam
Ahmadiyya-Sekte
Aleviten
Osmanisches Reich und die moderne Türkei
Schiiten
4. Islam und Christentum
"Heilsgeschichte" im Islam?
Jesu Geburt nach dem Koran
Jesu Kreuzigung in islamischer Sicht
Jesu Würdenamen im Koran
Maria (Maryam), die Mutter Jesu
“Schutzbefohlene“ - Christen und Juden unter islamischer Herrschaft
Was sagt der Koran zu der Beziehung zwischen Muslimen und Christen?
5. Islamische Gemeinschaft und Alltag
Abfall vom Islam (Irtidad)
Ängste im Volksislam
Arabisch – die Sprache des Islam
„Buße“ oder „Umkehr“ im Koran
Ehre und Schande
Frauen im Islam – islamische Eheverträge
„Friede“ im Islam
Gastfreundschaft
„Gute Werke“ im Islam
Hadith
“Haus des Krieges“ (dar al-harb) - die nicht-islamische Welt
Kindererziehung im Islam
Mann im Islam
Märtyrer im Islam
Mensch - nach den Aussagen des Koran
Moschee
Opferfest
Scharia - das islamische Recht
Sexualität im Islam
Umma - die islamische Gemeinschaft
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis der Minikurse:
Abfall vom Islam (Irtidad)
Ahmadiyya-Sekte
Aleviten
Anbetung im Islam
Ängste im Volksislam
Arabisch – die Sprache des Islam
Auferweckung der Toten nach dem Koran
Bekenntnis-Schahada
Beziehung zwischen Muslimen und Christen – Was sagt der Koran dazu?
Bibel: Der Glaube an die Bücher
Bireligiöse Ehen Mohammeds
Ehre und Schande
Engel - Dschinn
Fasten
Frauen im Islam – islamische Eheverträge
„Friede“ im Islam
Gastfreundschaft
Gebet im Islam
Gericht Gottes: Die Vorzeichen des Endgerichts im Islam
„Gute Werke“ – „sevap“ im Islam
Hadith
Hadsch – die muslimische Pilgerreise nach Mekka
“Haus des Krieges“ (dar al-harb) - die nicht-islamische Welt
Heiliger Geist im Islam
"Heilsgeschichte" im Islam?
Islamisierung
Jesu Geburt nach dem Koran
Jesu Kreuzigung in islamischer Sicht
Jesu Würdenamen im Koran
Kindererziehung im Islam
Koran, seine Entstehungsgeschichte und Überlieferung
Mann im Islam
Maria (Maryam), die Mutter Jesu
Märtyrer im Islam
Mensch - nach den Aussagen des Koran
Mission: Da`wah - Der Ruf zum Islam
Mohammed – ein echter Prophet?
Mohammeds Leben
Mohammed und seine Feinde
Moschee
Opferfest
Osmanisches Reich und die moderne Türkei
Paradieserwartung im Islam
Prädestination und freier Wille im Islam
Propheten
Quellen des Koran
Scharia - das islamische Recht
Schiiten
„Schutzbefohlene“ - Christen und Juden unter islamischer Herrschaft
Sexualität im Islam
Tauhid – der eine Gott
Umma - die islamische Gemeinschaft
Vergibt Allah? – „Vergebung“ im Koran
Zakat - Sozialabgaben
Minikurse nach Erscheinungsdatum mit Originaltitel und Autorenkürzel:
1997-1: Hadith KM
1997-2: Opferfest whä
1997-3: Da`wah - Der Ruf zum Islam KM
1997-4: Die Propheten whä
1997-5: Ahmadiyya whä
1997-6: Würdenamen Jesu im Koran KM
1998-1: Der Glaube an die Bücher KM
1998-2: Die Vorzeichen des Endgerichts im Islam KM
1998-3: Aleviten whä
1998-4: "Schutzbefohlene" - Christen und Juden unter islamischer Herrschaft KM
1998-5: Fasten KM
1999-1: Umma - die islamische Gemeinschaft whä
1999-2: Abfall vom Islam (Irtidad) KM
1999-3/4: Die Engel KM; Die Dschinn whä
1999-5: Die Kreuzigung Jesu in islamischer Sicht CS
1999-6: Die Geburt Jesu nach dem Koran KM
2000-1: “Haus des Krieges" (dar al-harb) - die nicht-islamische Welt KM
2000-2: Die Auferweckung der Toten nach dem Koran KM
2000-3/4: Kindererziehung im Islam CS
2000-5: Die Scharia - das islamische Recht whä
2000-6: Maria (Maryam), die Mutter Jesu KM
2001-1: "Heilsgeschichte" im Islam? KM
2001-2: Die Schiiten CS
2001-3/4: Bekennen-Bekenntnis-Schahada MK
2001-5: Ängste im Volksislam KT
2001-6: Der Mensch - nach den Aussagen des Koran KM
2002-1: Paradieserwartung im Islam KT
2002-2: Die Moschee MK
2002-3: Vergibt Allah? – „Vergebung“ im Koran MK
2002-4: Gebet im Islam MK
2002-5: Mohammeds Leben MK
2003-1: Zakat – Sozialabgaben KM
2003-2: Koran, seine Entstehungsgeschichte und Überlieferung MK
2003-3: Frauen im Islam – islamische Eheverträge CS
2003-4: -
2003-5: Mohammed – ein echter Prophet? MK
2004-1: Die „guten Werke“ im Islam“ MK
2004-2: „Friede“ im Islam KM
2004-3: Hadsch – die muslimische Pilgerreise nach Mekka MK
2004-4: Märtyrer im Islam KT
2004-5: Quellen des Koran MK
2005-1: Islamisierung KM
2005-2: Osmanisches Reich und die moderne Türkei RB
2005-3: Arabisch – die Sprache des Islam KM
2005-4: Ehre und Schande CS
2005-5: Was sagt der Koran zu der Beziehung zwischen Muslimen und Christen? BD
2006-1: Mann im Islam MK
2006-2: Mohammed und seine Feinde BD
2006-3: Prädestination und freier Wille im Islam CS
2006-4: Sexualität im Islam KT
2006-5: Anbetung im Islam MK
2007-1: Gastfreundschaft KM
2007-2: „Buße“ oder „Umkehr“ im Koran KM
2007-3: Heiliger Geist im Islam MK
2007-4: Bireligiöse Ehen Mohammeds BD
2007-5: Tauhid – der eine Gott GB
Hadith
Das arabische Wort "Hadith" (th - ausgesprochen wie stimmloses englisches "th" z.B. in "thin") bedeutet allgemein: Rede, Gespräch, Erzählung, Bericht. Im Zusammenhang mit der islamischen Religion erhielt es die Spezialbedeutung: Überlieferung (über Mohammed), Tradition.
Schon zu Lebzeiten Mohammeds wurden Berichte über Aussagen oder Taten des "Propheten" in mündlicher Form weitergegeben. Nach seinem Tod wuchs das Interesse an solchen meist kurzen, anekdotenhaften Erzählungen stark an. Die Überlieferung der Hadithen ist zunächst sicherlich Ausdruck für die Verehrung Mohammeds - die Erinnerung an ihn sollte wachgehalten werden - und Antwort auf das Informationsbedürfnis von Menschen, die mehr über den Islam und seinen Propheten wissen wollten. Dabei hatten die Hadithen schon früh eine starke prägende Bedeutung für das Leben der einzelnen Muslime und die islamische Gemeinschaft.
Denn der Koran, der Muslimen als das eigentliche Wort Gottes gilt, enthält für viele Fragen der religiösen Praxis und des Alttagslebens keine eindeutigen und detaillierten Anordnungen. Für den Islam ist es aber sehr wichtig, dass Menschen, die Gott gefallen wollen, sich in allen Einzelheiten vom Gesetz Gottes leiten lassen. Solange Mohammed lebte, konnten die Gläubigen sich nach seinem Vorbild richten oder ihn selber fragen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollten. Nach seinem Tod wurden diejenigen befragt, die ihn persönlich gekannt hatten und sagen konnten, was der Prophet in konkreten Lebenssituationen getan, gesagt, verurteilt oder auch stillschweigend geduldet hatte. Daraus konnte man ableiten, welche Entscheidungen am ehesten dem Vorbild Mohammeds (und damit, nach muslimischem Verständnis, dem Willen Gottes) entsprechen.
So wurde die aus den Hadithen ablesbare Gewohnheit (Sunna) des Propheten neben dem Koran die Hauptquelle für den "Islam" (= die richtige Form der Unterwerfung unter den Willen Gottes). Da der Islam nicht nur persönliche Gottesverehrung, sondern immer auch Politik und verbindliches Recht ist, werden aus Koran und Hadith die Rechtsnormen des islamischen Gesetzes abgeleitet. (In der Praxis wird auch heute ein Hodscha, wenn er in konkreten Angelegenheiten um Rat gefragt wird, öfter mit Hadith-Texten als mit Koranversen antworten.)
Mit der Zeit versuchten unterschiedliche politische und religiöse Richtungen innerhalb der islamischen Gemeinschaft, ihre jeweiligen Ansichten und Praktiken durch Hadithe zu untermauern. Es kam im 7. und 8. Jahrhundert eine große Zahl von gefälschten Hadithen in Umlauf. Das ließ es notwendig erscheinen, die verschiedenen Hadithen zu sammeln und kritisch zu sichten.
Die entstehende islamische Hadith-Wissenschaft konzentrierte sich dabei vor allem auf den Überlieferungsweg: es wurde versucht zurückzuverfolgen, wer den jeweiligen Bericht von wem gehört hatte - bis hin zu den direkten Augen- und Ohrenzeugen aus der Umgebung Mohammeds. Diese Überlieferer-Kette (Isnad) wurde dem eigentlichen Bericht über eine Aussage oder Handlungsweise Mohammeds (oder z.T. auch seiner engsten Gefährten) vorangestellt. Die Lebensläufe der Überlieferer wurden aufgezeichnet und die Zuverlässigkeit der jeweiligen Personen kritisch beleuchtet. Entsprechend der Vollständigkeit der Überlieferungs-Kette und der Zuverlässigkeit der Gewährsleute wurden die Hadithen in drei Kategorien eingeteilt:
1. sahih - echt, authentisch;
2. hasan - gut, aber nicht einwandfrei zuverlässig;
3. dhai`if - schwach, bedenklich.
Die wichtigsten sunnitischen Hadith-Sammlungen werden oft zitiert mit einem Kurztitel der Sammlung und einer verkürzten Namensform des Sammlers (in Klammern sind die Lebensdaten der Autoren genannt):
Sahih Buchari (810-870)
Sahih Muslim (817/821-875)
Sunan Abu Dawud (817-888)
Sunan Tirmidhi (815-892)
Während anfangs einige Hadith-Sammlungen nach den Namen der ursprünglichen Überlieferer geordnet wurden (Musnad), sind die genannten Werke nach thematischen Gesichtspunkten - entsprechend den Bedürfnissen der islamischen Rechtswissenschaft - aufgebaut (Musannaf). Themenkreise: Glaube, Wissen und religiöse Grundpflichten; Soziale Beziehungen, Regieren, Sitten und Gewohnheiten; Vorzüge bestimmter Personen, Auslegung, Einsatz für den Islam; Tugenden, Gehörtes (nach Khoury, S. 24f)
Die einzelnen Sammlungen umfassen zwischen 4.000 und 12.000 Hadithen. Der Sammler Abu Dawud soll von 500.000 ihm bekannten Überlieferungen nur 4.800 als zuverlässig anerkannt haben.
Aus den Hadith-Sammlungen wurden wieder Auszüge hergestellt, z.B. die unter dem Namen Miskhat bekannte und oft als Quelle der Gesetzespraxis benützte Sammlung.
Die Schiiten besitzen eine eigene Hadith-Literatur; sie erkennen nur solche Hadithen als gültig an, die auf Ali, den Neffen und Schwiegersohn Mohammeds, oder seine Anhänger zurückgeführt werden können.
Eine Auswahl von Hadithen in deutscher Sprache wurde 1988 vom Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn herausgegeben:
"So sprach der Prophet / Worte aus der islamischen Überlieferung / Ausgewählt und übersetzt von Adel Theodor Khoury"
(365 Seiten, davon rund 30 Seiten einleitende Informationen über den Hadith und über die islamische Religion).
www.orientdienst.de
Das Opferfest
Das "Opferfest" (arab.: 'Id Al-Adha, türk.: Kurban Bayram ) wird auch "das Große Fest" genannt, da es im Vergleich mit dem "kleinen Fest" des Fastenbrechens als das bedeutendere gilt. Das Fest beginnt immer am 10. Tag des islamischen Monats Dhu l-Hidschdscha und dauert vier Tage (?). Da das islamische Jahr ein Mondjahr ist und nur 354 oder 355 Tage umfaßt, verschieben sich die Feste in bezug auf unsere Jahreseinteilung jedes Jahr um 10 oder 11 Tage nach rückwärts. Das Opferfest beginnt 1997 am 19. April, 1998 am 9. April und 1999 am 29. März.
Die Opferung ist eines der Rituale während der Pilgerfahrt der Muslime nach Mekka. Im Tal von Mina bei Mekka werden dabei am festgesetzten Tag Hunderttausende von Tieren geschlachtet. Gleichzeitig wird dieses Opfer und das anschließende Fest auch von Muslimen in der ganzen Welt vollzogen. Gemäß der "Sunna" (der vorbildlichen Lebensweise des Propheten Mohammed) ist das Opfer verbindlich für jeden freien Muslim, der es sich leisten kann.
Geopfert wird meist ein männliches Schaf, möglich sind aber auch Ziegen, Kühe, Kamele. In der Regel schlachtet der Familienvater das Tier für seine ganze Familie. Die Tiere müssen fehlerfrei sein. Die Opferungshandlung wird nach einem festgesetzten Ritus vollzogen. Dabei wird das Opfertier mit dem Kopf Richtung Mekka gelegt. Der Vater oder derjenige, der an seiner Stelle schlachtet, spricht verschiedene Gebetsformeln, zerschneidet dann die Halsschlagader des Tieres und lässt es ausbluten. Ein Drittel des Fleisches verzehrt der Vater mit seiner Familie, zwei Drittel werden verschenkt - meist an ärmere Leute in der Umgebung.
Beim Schächten wird die Formel gesprochen: "Im Namen Gottes. Gott ist groß. Herr Gott, in deinem Namen, durch dich und für dich. Nimm es von mir an, wie du es von deinem Freund Abraham angenommen hast." Das Opferfest ist das "Fest Abrahams". Obwohl die Opfer auf vorislamische Bräuche während der Pilgerfahrt zurückgehen, verbindet die islamische Überlieferung sie mit Abraham, der im Tal Mina seinen Sohn Ismael (nicht Isaak! - im Koran selbst wird allerdings gar kein Name erwähnt) auf Befehl Gottes zu opfern bereit gewesen sein soll. Gott habe dann Ismael "mit einem großes Schlachtopfer" (Koran 37, 106 - hier ähnelt die koranische Darstellung dem biblischen Bericht) ausgelöst. Der Engel Gabriel bringt als Ersatz für das Menschenopfer einen Hammel als Opfertier.
Welche Bedeutung verbinden Muslime mit dem Opfer? Im Koran wird betont, dass sich Abraham und sein Sohn "ergeben gezeigt" hätten (37, 103). Die Opferbereitschaft Abrahams und auch das Opfer der Muslime soll also Ausdruck der unbedingten Hingabe, des bedingungslosen Gehorsams des Menschen an Gott sein. Der Gläubige, der das Opfer vollzieht, stellt damit sein ganzes Leben Gott zur Verfügung. "Wenn einer die Opfertiere Gott hochhält, ist es ein Ausdruck der Frömmigkeit des Herzens." (Koran 22, 32)
Denken Muslime bei ihrem Opfer auch daran, Gott damit gnädig zu stimmen? Kann man gar davon sprechen, dass das Opfertier stellvertretend für die Sünde des Menschen sterben muss? Gegen den Gedanken einer "Versöhnung" durch das Opfer spricht Sure 22,37, wo es von den Opfertieren heißt: "Weder ihr Fleisch noch ihr Blut erreicht Gott, aber Ihn erreicht eure Frömmigkeit". Im Opfer hofft der Muslim nicht etwa auf eine Stellvertretung für seine Sünden, sondern bringt symbolhaft Gott seine eigene Frömmigkeit dar. Der Gedanke, dass ein anderer stellvertretend für den Menschen die Strafe übernehmen und dadurch Versöhnung erwirken könne, wird im Koran und in der islamischen Überlieferung sehr hart abgelehnt (Sure 6,164).
Und doch scheint das Opfer einer jener Bestandteile im Islam zu sein, in dem das Licht der biblischen Wahrheit nicht ganz ausgelöscht werden konnte. Sure 37, 107 spricht davon, dass der Sohn Abrahams mit einem Schlachtopfer "ausgelöst" wurde. Ein Tier starb an seiner Statt. Opfer werden von vielen Muslimen auch nicht nur anlässlich des Opferfestes gebracht. Im Volksislam haben Tieropfer ihren Platz auch z.B. bei Hochzeiten oder Begräbnissen, zur Besiegelung der Versöhnung zwischen Menschen und als Schutz vor bösen Geistern. Vielfach spielt dabei doch der Gedanke mit, dass Tieropfer ein Mittel zur Reinigung von Schuld sein könnten.
So kann das Opferfest eine gute Gelegenheit sein, Muslime auf die Bedeutung der biblischen Opfer hinzuweisen: Die im Alten Testament von Gott seinem Volk gebotenen Opfer sind ein Hinweis darauf, dass zur Vergebung der Schuld und Erlösung von Sünde stellvertretend Leben gegeben werden muss. Ohne Blutvergießen keine Vergebung (Hebräer 9,22). So schwerwiegend ist unsere Verlorenheit, dass die Darbringung unserer "eigenen Frömmigkeit" niemals zur Sühne ausreichen kann.
Alle alttestamentlichen Opfer und unbewusst auch die Opfer der Religionen inklusive des Islam weisen auf das eine große Opfer hin, durch das Gott selbst uns auslöst: das Sterben des sündlosen Sohnes Gottes, Jesus Christus. Er ist "Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt" (Johannes 1,29). Weil er ein für allemal (Hebräer 9,28) das für alle ausreichende Opfer gebracht hat, sind seitdem keine Tieropfer mehr nötig. Wer Tieropfer bringt, weist dadurch bewusst oder unbewusst das Versöhnungsangebot Gottes zurück.
www.orientdienst.de
Da`wah - Der Ruf zum Islam
Muslime reden in der Regel nicht gern von islamischer "Mission", denn Gesandte (= Missionare) Gottes sind eigentlich nur einige der wichtigsten Propheten. Mit der Sendung Muhammads, des "Siegels der Propheten" (Sure 33,40) und der Herabsendung des Koran ist die göttliche Mission zum Abschluss gekommen.
Dennoch ist der Islam in dem Sinne eine "missionarische" Religion, dass er auf Ausbreitung angelegt ist. Er beansprucht universale Gültigkeit (Sure 34,28). Sein Ziel ist die Aufrichtung der islamischen Ordnung bzw. Herrschaft über die ganze Welt und über alle Lebensbereiche aller Menschen.
Diesem Ziel dienen die verschiedenen Formen oder Stufen des "Dschihad", der Anstrengung für die Sache Allahs. Dschihad kann passiver Widerstand oder sogar nur innere, gedankliche Verurteilung einer unislamischen Handlungsweise sein, aber auch verbale Angriffe gegen andere, als verkehrt angesehene Religionen bis hin zum bewaffneten Kampf umfassen.
"Da`wah" ist eine Form des Dschihad. Sie kann von Muslimen als "Dschihad mit Worten" bezeichnet werden (Ömer Öngüt; Islam, Istanbul 1996, S. 334f).
Die Grundbedeutung des arabischen Wortes "da`wah" ist: Ruf. Es kann außerdem Aufruf, Aufforderung, Einladung, Propaganda etc. bedeuten. Im Kontext des islamischen Rechts ist "Da`wah" der Ruf oder die Einladung an Einzelne oder Gruppen von Menschen, den Islam anzunehmen bzw. sich Allah zu unterwerfen. Dabei
werden sie nach islamischem Verständnis aufgefordert, zum Islam zurückzukehren, da ja alle Menschen eigentlich als Muslime geboren werden.
Als koranische Grundlage für die Da`wah wird oft Sure 16,125 zitiert: "Rufe zum Weg deines Herrn mit Wahrheit und guter Ermahnung und streite mit ihnen auf die beste Art..."
Unterschiede zwischen biblischer "Mission" und islamischer "Da`wah"
Aus der Tatsache, dass der Islam innerweltlich die Herrschaft Allahs aufrichten und ausweiten will und keine strikte Trennung von Religion und Staat kennt, ergeben sich grundlegende Unterschiede zwischen der islamischen "Da`wah" und dem biblischen Missionsverständnis:
A - Nach biblischem Verständnis kann die Gemeinde Jesu Christi nur durch "Mission" aufgebaut und ausgebreitet werden.
"Da`wah" ist eine Form der Ausbreitung des Islam unter vielen anderen.
B - Das Ziel biblischer Missionstätigkeit ist, dass Menschen die Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus hören und zum persönlichen Glauben an ihn kommen, um dadurch ewiges Leben zu empfangen und in seine Gemeinde eingefügt zu werden.
Im Islam liegt der Schwerpunkt nicht auf persönlicher Gläubigkeit oder gar der festen Zusage des ewigen Heils (darüber wird ja Allah erst am Tag des Gerichts entscheiden), sondern darauf, dass die islamische Ordnung das öffentliche Leben beherrscht.
Deshalb ist es im Blick auf die "Schriftbesitzer" (Christen, Juden und Zoroastrier) ausreichend, wenn sie dem Machtbereich des Islam unterworfen sind; als Einzelne müssen sie nicht zum Islam übertreten, sondern können - im Rahmen der islamischen Ordnung! - ihren Glauben beibehalten. Da man ungern auf die von ihnen zu zahlende Kopfsteuer verzichten wollte, wurden sogar zeitweilig, wie z.B. im Osmanischen Reich, Massenübertritte zum Islam gar nicht gern gesehen. (Nur die eigentlichen Polytheisten müssen bis zur Annahme des Islam bekämpft werden - was allerdings auch nicht immer und überall geschah.)
Da`wah wendet sich oft in besonderer Weise an Personen in Schlüsselstellungen, um möglichst wirksam gesellschaftliche Strukturen beeinflussen zu können.
C - Mission im biblischen Sinn geht nicht über die Verkündigung des Wortes Gottes hinaus; alles Weitere muss sie dem Wirken des Heiligen Geistes und der Entscheidung jedes einzelnen Zuhörers überlassen.
Laut Koran 9,60 können Mittel aus der sogenannten "Almosensteuer" (Zakat) unter anderem verwandt werden für Menschen, "die (für die Sache des Islam) gewonnen werden sollen" (R. Paret). Das entspricht auch der Praxis Mohammeds.
Im Islam wird (unter Hinweis auf Sure 2,256) oft betont, dass auf die Schriftbesitzer kein Zwang ausgeübt werden dürfe, Muslime zu werden. Dennoch kann es auch ihnen gegenüber Gründe zur Gewaltanwendung geben: 1. um zu verhindern, dass Muslime in fremden Ländern der Unterdrückung, Verfolgung oder Verführung (evtl. durch christliche Mission) ausgesetzt werden; 2. um die Verhinderung islamischer Missionstätigkeit in nicht-islamischen Ländern zu bekämpfen (Khoury, Was sagt der Koran zum Heiligen Krieg?, S. 18).
So kommt sehr nahe hinter dem "Wort" das "Schwert" zum Vorschein. Es gibt keine eindeutige und vor allem keine unüberschreitbare Grenze zwischen friedlicher Einladung zum Islam und der Androhung und Anwendung von Gewalt.
Das heißt nicht, dass der Islam sich in vielen Gegenden nicht auf friedlichem Wege ausgebreitet habe: Oft waren es muslimische Händler und Reisende, die durch ihr Vorbild und ihre Verkündigung Menschen in ihrer Umgebung bewogen, den Islam anzunehmen.
D - Biblische Mission wendet sich vor allem an Herz und Gewissen eines Menschen, um ihm zu zeigen, dass er als Sünder Vergebung braucht, und um ihn einzuladen, die Versöhnung mit Gott als Geschenk Seiner Gnade anzunehmen.
Da`wah richtet sich stärker an Verstand und Willen eines Menschen, um ihn von der Vernünftigkeit des reinen islamischen Monotheismus und der heilsamen Ordnung des islamischen Gesetzes zu überzeugen und zur Annahme des Islam aufzufordern.
Da`wah geschieht häufig in Form von Informationsveranstaltungen ("Islamischen Wochen" etc.) und Debatten. Muslime in Europa versuchen dabei, ein möglichst positives Bild vom Islam zu zeichnen, z.T. indem sie Sachverhalte, die für westliche, humanistisch geprägte Menschen anstößig sein können (z.B. die Stellung der Frau, die Strafen für den Abfall vom Islam), umgehen oder entschärfend interpretieren. Andererseits benutzen sie die Schriften bibelkritischer "christlicher" Theologen, um den christlichen Glauben als unvernünftig und überholt darzustellen.
www.orientdienst.de
Die Propheten
Laut islamischer Lehre verpflichtete Gott Adam und seine Kinder, sich ihm zu unterwerfen und ihm allein zu dienen (Sure 36,60-61). Jeder Mensch ist daher von Natur aus Muslim, der Islam die schöpfungsgemäße Religion (vgl. Sure 30,30).
Weil die Menschen dennoch immer wieder vom Weg Gottes abwichen, sandte Gott Propheten. Sie waren Künder seiner Botschaft an ein besonderes Volk oder auch an die ganze Menschheit. Den Propheten wiederum vermittelte der unendlich ferne Gott seine Botschaft durch Engel. So soll der Prophet Mohammed seine Offenbarungen jeweils durch den Erzengel Gabriel erhalten haben.
Der Glaube an alle Propheten gehört zu den fundamentalen Glaubensartikeln des Islam.
Propheten in großer Zahl
Der Islam legt sich nicht darauf fest, wie viele Propheten Gott im Laufe der Menschheitsgeschichte berufen hat. Einige Koranstellen gehen davon aus, dass zu jedem Volk zu irgendeiner Zeit ein Warner gesandt wurde (Sure 13,7b; 35,24). Namentlich werden im Koran 25 Propheten erwähnt. 19 dieser Namen haben eine Entsprechung im Alten oder Neuen Testament: Adam, Noah, Abraham, Ismael, Isaak, Lot, Jakob, Josef, Moses, Aaron, David, Salomo, Elia, Elisa, Jona, Hiob, Zacharias, Johannes der Täufer und Jesus.
Als letzter Prophet und Bote Gottes für die ganze Welt gilt Mohammed. Er wird als das "Siegel der Propheten" bezeichnet. Damit wird behauptet, dass er alle Prophetien der Vergangenheit bestätigt, vollendet und abgeschlossen habe.
Das arabische Wort für "Prophet" ist "nabi", was wörtlich "Künder" bedeutet. Einige der Boten Gottes werden jedoch auch als "rasul" (Gesandter) bezeichnet. Manche theologische Schulen des Islam sehen beide Titel als gleichbedeutend. Laut anderer Theologen wird als "rasul" nur ein solcher Prophet bezeichnet, dem von Gott ein Buch oder ein neues Gesetz offenbart wurde.
Botschaft
Die Botschaften der Propheten können in den Einzelheiten voneinander abweichen - je nach dem Volk, zu dem ein Prophet gesandt wurde und je nach den Besonderheiten der kulturellen und geschichtlichen Situation. Die Grundaussage ihrer Verkündigung ist jedoch immer die gleiche: Der Ruf zur Umkehr von den Götzen zu dem einzigen Gott angesichts des herannahenden Gerichtes Gottes (Sure 21,25).
Jeweils ist der Prophet mit seiner Botschaft auf Widerstand und Anfeindung gestoßen. Jeweils hat Gott jedoch ihn und seine Botschaft bestätigt (dazu gehört ein Beglaubigungswunder, das Gott durch jeden Propheten wirkt) und diejenigen, die im Unglauben verharrten, bestraft.
Um die Glaubwürdigkeit seiner Propheten zu sichern, hat Gott ihnen laut heute anerkannter islamischer Theologie auch Sündlosigkeit geschenkt. Der Koran allerdings setzt durchaus die Sündhaftigkeit auch der Gesandten Gottes voraus (z.B.: Adam - 2,35-38; Noah - 11,46-47; Abraham - 26,82-83; Mohammed - 40,55; 47,19; 48,1-2).
Nach dem Bilde Mohammeds
Das ständig wiederkehrende Schema in der Darstellung der Propheten vor Mohammed deutet auf ein wichtiges Merkmal der islamischen Lehre von den Propheten: Mohammed benutzt die alten Prophetengeschichten vor allem dazu, seine eigene Sendung zu rechtfertigen und zu untermauern (vgl. Sure 4,163-165): Seine Botschaft wird von manchen Mekkanern nicht geglaubt? Aber die gleiche Botschaft haben doch schon viele Propheten vor ihm verkündet. Mohammed wird verspottet? So ging es ja auch den Boten Gottes vor ihm (Sure 43,7) - und sie erlebten Gottes Strafgericht über die Spötter (Sure 43,8).
Hinter diesem auf Mohammed gemünzten Schema verblasst der besondere Charakter der einzelnen Propheten. Das wird besonders deutlich, wenn man die Aussagen von Koran und Bibel über von beiden genannte Personen vergleicht. Im Gegensatz zu den sehr unterschiedlichen Charakteren der biblischen Propheten besitzen die koranischen Propheten kaum eigenständige Bedeutung. Sie sind 'nach dem Bilde Mohammeds' geschaffen.
Der Islam stellt oft seinen "Glauben an alle Propheten" als beispielhaft tolerant dar. Bei Licht betrachtet bleibt jedoch nur der sehr einseitige Glaube an einen Propheten (Mohammed) und der Glaube an seine Sicht des Prophetentums, der alle vorherigen Propheten einverleibt werden. Mohammed hat sozusagen alle Propheten vor ihm ohne deren Einverständnis zu Muslimen gemacht. Während in der Bibel eine Vielzahl von Zeugen mit ihrer unverwechselbaren persönlichen Färbung den einen Gott und seinen Erlöser verkünden, tritt uns im Koran nur ein Zeuge entgegen. Allein durch seine Brille dürfen die Boten Gottes vor ihm gedeutet werden.
Jesus - einer von vielen
Besonders schmerzhaft ist für uns Christen, wie auch Jesus in dieses Schema der Bestätigung Mohammeds eingeordnet wird. Ausdrücklich wird betont, dass er "nichts anderes als ein Gesandter" (Sure 5,75) wie viele vor ihm sei und "nichts als ein Diener" (Sure 43,59). Seine Gottessohnsschaft und Gottheit werden in aller Schärfe abgelehnt (Sure 4,171; 5,17 + 116; 9,30-32 u.a.)
Und doch findet sich selbst im Koran eine Ahnung davon, dass Jesus eine über alle anderen Propheten herausgehobene Stellung innehat. So wird er mit einigen herausragenden Titeln bezeichnet (z.B. "Messias" - Sure 4,171 u.a.; "Wort Gottes" - 3,45; 4,171; "Geist von Gott" - 4,171...).
Über sündiges Verhalten Jesu (im Gegensatz zu anderen Propheten, s.o.) macht selbst der Koran nicht die geringste Andeutung.
www.orientdienst.de
Ahmadiyya
Wer in westlichen Großstädten auf einen Büchertisch mit "missionierenden" Muslimen trifft, hat es dort sehr häufig mit "Ahmadis" zu tun, den Anhängern der "Ahmadiyya Muslim Jamaat" (Jamaat = Gemeinde). Mit Eifer, bunten Broschüren und auf den Westen zugeschnittenen Parolen versuchen Ahmadis, die eigene Vorstellung vom Islam auch christlichen Ländern zu propagieren. So rief der 3. Khalif der Bewegung bei einer Rede in London aus: "Kommt her und nehmt den Islam an,..., denn darin liegt all Euer eigenes Gutes und das Gute Eurer zukünftigen Generationen..."
Geschichte
Der Begründer der Ahmadiyya-Gemeinde, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad wird 1835 in Qadian in Nordindien geboren. Aufgrund angeblicher Offenbarungen Allahs erklärt er sich zum "Auserwählten Gottes", später zum Propheten. Ghulam Ahmad beansprucht, die Erfüllung von Verheißungen verschiedener Religionen zu sein. In ihm ist der Messias Jesus, der verheißene Krischna und der Imam Mahdi, den die Schiiten erwarten, gekommen.
Seine Aufgabe sieht Ghulam Ahmad darin, den Islam zu reinigen, wiederzubeleben und weltweit auszubreiten. Er verheißt seinen Anhängern, "innerhalb von 300 Jahren nach ihrer Entstehung werde die Gemeinde nahezu die ganze Welt umfassen, so dass die Erde in die Bruderschaft des Islams eintreten wird."
1889 gründet Ahmad die "Ahmadiyya Muslim Jamaat" und beginnt eine rege Missionstätigkeit, die nach seinem Tod im Jahre 1908 von seinen Nachfolgern (Khalifen) weltweit fortgesetzt wird. 1913 schickt man den ersten Missionar nach England, 1920 nach Amerika, 1923 nach Deutschland.
Seit Beginn einer systematischen Verfolgung der Ahmadiyya durch sunnitische Muslime in Pakistan kamen viele pakistanische Ahmadis als Asylbewerber nach Deutschland. Nach Angaben der Bewegung gab es 1994 20.000 Anhänger in Deutschland, davon vermutlich nur ca. 200 Deutsche. Weltweit soll die Ahmadiyya 12 Millionen Mitglieder haben. Sie ist besonders stark in Westafrika verbreitet. In Gambia gab es in den sechziger Jahren sogar schon einmal einen Ahmadi als Staatsoberhaupt. Führer der weltweiten Gemeinde ist der vierte Khalif, Hazrat Khalifatul Masih IV.
Sind Ahmadis Muslime?
Das pakistanische Parlament verabschiedete im Jahr 1974 eine Resolution, in der alle Ahmadis zu Nicht-Muslimen erklärt wurden. Dabei verstand sich Mirzat Ghulam Ahmad, der Gründer der Ahmadiyya, ja als Reiniger des Islam. Die üblichen Lehren und Pflichten des Islam werden bis heute von jedem Ahmadi akzeptiert.
Stein des Anstoßes ist für die anderen Muslime vor allem die Lehre von den Propheten. Nach ihnen war Mohammed der letzte Gesandte Gottes, das "Siegel der Propheten". Zwar erkennen Ahmadis Mohammed als letzten gesetzgebenden Propheten an. Nach ihm habe es jedoch immer wieder sogenannte "Schattenpropheten" gegeben, zu denen auch Ghulam Ahmad gehört habe. Auch diese Mohammed untergeordneten Männer, hören Gottes Stimme und geben seinen Willen weiter.
Unterschiede zur islamischen Orthodoxie gibt es auch in der Darstellung der Geschichte Jesu. Die meisten islamischen Theologen lehren, Gott habe einen anderen an Jesu Stelle kreuzigen lassen. Jesus sei leibhaftig in den Himmel aufgenommen worden. Der Gründer der Ahmadiyya behauptete dagegen, Jesus sei gekreuzigt worden, aber nur scheintot gewesen. Seine Jünger hätten ihn gepflegt, bis er stark genug gewesen sei, nach Kaschmir im heutigen Indien auszuwandern. Dort habe er den verlorenen Stämmen Israels gepredigt und sei im Alter von 120 Jahren eines natürlichen Todes gestorben. So abenteuerlich diese Geschichte auch ist - sie hat selbst in nicht-muslimischen Kreisen Resonanz gefunden.
Pluspunkte können Ahmadis im Westen dadurch verbuchen, dass sie bei der Ausbreitung des Islam Gewalt ablehnen. In der Auseinandersetzung um den Schriftsteller Rushdie beispielsweise hoben sie sich damit vom fundamentalistischen Islam ab. "Dschihad" (heiliger Krieg) ist für sie die Ausbreitung des Islam mit friedlichen geistigen Mitteln.
Christen und Ahmadis
Eine besondere Herausforderung für Jünger Jesu stellt die Ahmadiyya-Gemeinde insofern dar, als sie sich in ihren Missionsbemühungen offensiv an die christliche Welt wendet. So wurde z.B. auf dem Frankfurter Kirchentag 1987 von Ahmadis ein "Offener Brief an die Christenheit" verteilt. Ahmadiyya- Missionare versuchen, mit Bibelzitaten und logischen Schlüssen zu beweisen, dass Jesus nicht Gott war, dass er nur scheintot war oder dass Mohammed schon in der Bibel verheißen wurde.
Christen werden sich im Gespräch mit Ahmadis auf argumentativ geführte Diskussionen einzustellen haben und dabei ihre Bibel gut kennen müssen.
Auch wenn Ahmadis die Ausbreitung des Glaubens mit Gewalt ablehnen und stärker als andere Muslime geistige Werte betonen: Die Ahmadiyya lehnt, wie der orthodoxe Islam gerade die entscheidenden Heilstatsachen ab: die Gottessohnschaft Jesu und seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Daher stellt auch die Ahmadiyya eine anti-christliche Lehre dar. Ihr Gründer Mirzat Ghulam Ahmad, der sich als wiedergekommenen Messias bezeichnete, fällt unter das Urteil Jesu: "Es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen." (Mt. 24,23-24a)
Weitere Informationen zur Ahmaddiya-Sekte und ihrer Beurteilung finden Sie bei: www.haensel-hohenhausen.de unter "Ahmadiyya-Bewegung des Islam", ein Buch von Hiltrud Schröter, 4.Aufl., 2005, 167 Seiten, ISBN 3-8267-1206-4
www.orientdienst.de
Würdenamen Jesu im Koran
Der Koran verleiht Jesus einige hohe Titel. In ihnen klingen z.T. biblische Wendungen an. Bei einer genaueren Untersuchung zeigt sich jedoch, wie wenig wir ein gemeinsames Verständnis voraussetzen können, selbst wenn Muslime Begriffe gebrauchen, die den christlichen entsprechen. Vieles müssen wir Muslimen von der Bibel her erklären, wenn wir ihnen bezeugen wollen, wer Jesus Christus wirklich ist.
In Sure 4, 171+172 werden - in einer Auseinandersetzung Mohammeds mit den "Leuten des Buches" - die wichtigsten Würdenamen genannt, die der Koran Jesus beilegt:
"O ihr Leute des Buches, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt über Gott nur die Wahrheit. Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist doch nur der Gesandte Gottes und sein Wort, das er zu Maria hinüberbrachte, und ein Geist von Ihm. So glaubt an Gott und seine Gesandten. Und sagt nicht: Drei. Hört auf, das ist besser für euch. Gott ist doch ein einziger Gott. Gepriesen sei Er und erhaben darüber, dass Er ein Kind habe... <172> Christus wird es sicher nicht aus Widerwillen ablehnen, Diener Gottes zu sein..."
1. Christus (Al-Masih) - Der Koran geht an keiner Stelle auf die Bedeutung des Titels Al-Masih (Messias) ein. Z.T. wird er wie ein Namensbestandteil ohne weiteren Inhalt behandelt, manchmal einfach anstelle von "Jesus" gebraucht (z.B. Sure 5,72). Einzelne Koranausleger kennen durchaus die Bedeutung "der Gesalbte. Sie legen diesen Begriff unterschiedlich aus: Jesus sei mit dem Segen Gottes gesalbt; seine Salbung bedeute seine Sündlosigkeit oder seine Berufung zum Propheten. - Der Koran kennt Jesus aber nicht als den im Alten Testament verheißenen "Gesalbten", der seinem Volk Heil und Erlösung bringt.
2. Sohn der Maria (Ibn Maryam) - Die Nennung eines Sohnes nach der Mutter hat in der Regel einen negativen Beiklang, denn sie kommt nur vor, wo der Vater unbekannt ist. Der Koran betont jedoch die Unbescholtenheit Marias (21,89) und bestätigt die biblische Lehre der Jungfrauengeburt (3,47). Dabei wird allerdings hervorgehoben, dass Jesus und seine Mutter nichts anderes als Menschen waren: "Beide pflegten Speise zu essen." (5,75) - Einerseits bezeugt also auch der Koran die Einzigartigkeit der Geburt Jesu. Andererseits verneint er aber, dass damit ein zeichenhafter Hinweis auf einen besonderen Auftrag Jesu oder gar auf seine Gottessohnschaft verbunden sei.
3. Gesandter Gottes (Rasul Allah) - Mit der Aussage, dass Jesus "nur" der Gesandte Gottes sei, bekämpft der Koran die "Übertreibung" der Christen, die in ihm etwas Höheres als Mohammed sehen wollen. Der Islam meint, Jesus mit dem Titel "Gesandter Gottes" oder auch "Prophet" (19,30) hoch zu ehren. Ihm wird jedoch nur eine begrenzte Sendung (zu den 12 Stämmen Israels) zuerkannt. Teil seines Auftrags war es, den letzten Gesandten Mohammed anzukündigen.
4. Wort Gottes (Kalimat-hu) - Nach dem Verständnis vieler Koranausleger bedeutet diese Bezeichnung, dass Jesus durch das Wort bzw. den Befehl Gottes geschaffen worden sei; sie bezeugt also vor allem die Allmacht Gottes. Der Koran unterstreicht: "Mit Jesus ist es vor Gott wie mit Adam. Er erschuf ihn aus Erde, dann sagte Er zu ihm: Sei! und er war" (3,59). Andere erklären diesen Titel damit, dass Jesus das Wort Gottes zu den Menschen gebracht habe. - Die biblische Auffassung, dass Jesus in Person mit seinem ganzen Leben und seinem Tod das entscheidende Wort Gottes für alle Menschen sei und dass er als "Wort Gottes" von Ewigkeit her bei Gott war, teilt der Koran nicht.
5. Ein Geist von Gott (Ruhun minhu) - Diese Wendung besagt nach islamischem Verständnis, dass Jesus durch das Einhauchen des göttlichen Geistes von Maria empfangen wurde (21,91). An verschiedenen Stellen (2, 87+253; 5,110) kann der Koran davon reden, dass Allah Jesus durch den Geist der Heiligkeit gestärkt und ihn so zu Wundertaten befähigt habe.
6. Diener / Sklave Gottes (Abd Allah) - Mit dieser Bezeichnung wird Jesus im Grunde auf die gleiche Stufe wie alle Menschen gestellt (19,93). Der Ausdruck "Sklave Gottes" ist allerdings nicht erniedrigend oder entwürdigend zu verstehen; im koranischen wie im biblischen Sinn weist er hin auf die hohe Bestimmung des Menschen, Gott zu dienen. - Der Koran weiß jedoch weder etwas von dem stellvertretend leidenden Gottesknecht nach Jesaja 53 noch von dem Sohn Gottes, der sich selbst erniedrigte und Knechtsgestalt annahm (Phil 2,7).
Weitere Bezeichnungen für Jesus, die an anderen Stellen im Koran vorkommen, sind: Gerechter (6,85); Angesehener und einer von den Nahegebrachten (3,45); ein Zeichen für die Menschen (19,21); ein Vorbild (43,59); der Zeuge (4,159).
Von entscheidender Bedeutung ist auch, was der Koran nicht über Jesus sagt bzw. welche Titel er vehement zurückweist: Sehr deutlich wird in Sure 4,171 die Ablehnung der Trinität und der Gottessohnschaft ausgesprochen. Andere Texte betonen ähnliches: er ist nicht Allah (5,17) und er ist nicht Sohn Gottes (9,30). (Die Gottessohnschaft Jesu wird im Islam unter anderem aufgrund des Missverständnisses einer sexuellen Zeugung abgelehnt.)
Im Koran werden Jesus Würdenamen verliehen, die ihn eigentlich über alle anderen Propheten erheben. (Das bringt manche Muslime dazu, mehr über Jesus wissen zu wollen.) Sie werden aber jeweils so gedeutet, dass Jesus völlig in den Rahmen des islamischen Prophetenverständnisses eingepasst wird. Trotz der hohen Titel weiß der Koran nichts davon, dass in Jesus der verheißene Christus Gottes erschienen ist, der als Sohn und Knecht Gottes gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz, der sein Leben hingab "zu einer Erlösung für viele" und in dem sich Gott selber offenbart.
www.orientdienst.de
Der Glaube an die Bücher
Mohammed soll einmal von dem Engel Gabriel gefragt worden sein, was der islamische Glaube beinhalte. Seine im Hadith überlieferte Antwort war:
"Der Glaube ist, dass du an Allah, Seine Engel, Seine Bücher, Seine Gesandten, den Jüngsten Tag und die göttliche Vorsehung, das heißt, dass Allah Gutes und Böses zuvor festgelegt hat, glaubst."
Für Muslime gehört es zu den sechs grundlegenden, absolut verbindlichen Glaubensverpflichtungen, an die Bücher zu glauben, die Allah durch Seine Propheten zu den Menschen gesandt hat.
Islamische Theologen vertreten die Auffassung, dass Gott zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Völkern jeweils in ihrer Sprache eine heilige Schrift habe zukommen lassen. Ursprünglich sei der Inhalt aller heiligen Bücher im wesentlichen der gleiche gewesen, und jede spätere Schrift habe die vorherige bestätigt. Zugleich habe allerdings auch die neuere Schrift jeweils die ältere ersetzt. - Manche Muslime reagieren deshalb erstaunt, wenn sie erfahren, dass zur Bibel der Christen außer dem Evangelium auch die älteren Schriften von Mose, David und anderen gehören.
Der Sinn der Bücher besteht nach islamischem Verständnis darin, den Menschen den Weg der Rechtleitung zu zeigen und sie vor Irrwegen zu warnen, damit sie im Diesseits und im Jenseits Glück und Wohlergehen erlangen.
Welche heiligen Bücher gibt es?
Der Koran erwähnt "Seiten" oder "Blätter" (Suhuf) Abrahams (Sure 87,19) und anderer Propheten, die allerdings alle nicht erhalten geblieben sind und über deren Inhalt der Koran auch nichts Näheres mitteilt.
Die Bücher, die im Koran genannt werden und denen nach muslimischen Aussagen große Bedeutung zukommt, sind:
- Die Taurat (Thora) Moses,
- Der Zebur (Psalter) Davids,
- Das Indschil (Evangelium) Jesu und
- Der Koran Mohammeds.
Im Gespräch betonen Muslime gern, dass sie alle Bücher anerkennen, die von Gott offenbart wurden. Sie beziehen sich dabei oft auf Sure 2, 136: "Sprecht: Wir glauben an Gott und an das, was zu uns herabgesandt wurde, und an das, was herabgesandt wurde zu Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und den Stämmen, und an das, was Mose und Jesus zugekommen ist, und an das, was den (anderen) Propheten von ihrem Herrn zugekommen ist. Wir machen bei keinem von ihnen einen Unterschied. Und wir sind Ihm ergeben."
Verfälschung der Schriften
Fragt man allerdings, ob sie also auch z.B. das Evangelium lesen, erhält man in der Regel die Antwort: "Wir glauben an alle Bücher in ihrer unverfälschten Urform. Alle Bücher außer dem Koran sind jedoch leider verfälscht worden. Im übrigen ist alles Wesentliche im Koran enthalten."
Weitere Rückfragen, wer denn wann die anderen (biblischen!) Bücher verfälscht habe und welche geschichtlichen Belege es dafür gebe, werden zumeist nur sehr vage oder mit Hinweisen auf die Forschungen neuerer christlicher Theologen beantwortet (s. Artikel "Warum Muslime die Bibel für verfälscht halten", S. 7-11).
Von praktischer Bedeutung ist für Muslime also lediglich der Koran. (Für die Christen und Juden selber mögen jedoch - trotz aller angeblichen Verfälschungen - ihre jeweiligen Schriften in gewissem Rahmen verbindlich bleiben.)
Das entscheidende Buch: der Koran
Nach islamischer Auffassung wurde der Koran dem Propheten Mohammed durch den Engel Gabriel überbracht. Beginnend mit der Berufung Mohammeds zum Propheten bis kurz vor seinem Tod übermittelte der Engel ihm zu den verschiedenen Offenbarungsanlässen jeweils einzelne Verse oder kurze Suren (Kapitel des Koran), die wortwörtlich mit einer im Himmel aufbewahrten Urschrift (Sure 43,2-4 und 85,21+22) übereinstimmen. Mohammed ließ die jeweils offenbarten Abschnitte von seinen Gefährten aufschreiben und auswendig lernen. Nach seinem Tod wurde der Koran so in Buchform gebracht, wie es Mohammed kurz vorher angeordnet hatte. Die endgültige Festlegung des Korantextes erfolgte durch den 3. Kalifen, Othman, im Jahre 653, 21 Jahre nach Mohammeds Tod. (Tatsächlich scheint die Zusammenstellung und Überlieferung des Korantextes allerdings komplizierter gewesen zu sein.)
Muslime sehen den Koran als Gottes endgültige Offenbarung, die alle anderen Bücher relativiert und korrigiert. Er ist nach ihrer Meinung völlig unverfälscht überliefert worden - und stellt nach Ausdrucksweise und Inhalt ein solches Wunder dar, dass niemand auch nur eine seiner kleinsten Suren nachahmen kann. Nur in seiner arabischen Urform ist er wirklich "der Koran"; Übersetzungen geben lediglich seinen ungefähren Sinn wieder.
Eine Untersuchung und Beurteilung des Koran mit Mitteln der Literatur- oder Geschichtswissenschaft ist deshalb für viele gläubige Muslime völlig undenkbar und wird möglichst unterdrückt (vgl. die Prozesse gegen den Literaturprofessor Nasr Hamid Abu Zaid in Ägypten seit 1993).
Für den Islam ist der Koran vor allem die Hauptquelle für das islamische Recht - nicht ein "Brief" Gottes, der den Weg zur Rettung von der Macht der Sünde und zur Gemeinschaft mit Gott zeigt.
Den Koran auswendig zu lernen und Korantexte zu rezitieren gilt als sehr verdienstvoll.
Koranverse werden auch zur Herstellung von Amuletten und wunderwirkenden "Medizinen" benutzt.
www.orientdienst.de
Die Vorzeichen des Endgerichts im Islam
Der kommende Tag des Gerichts ist für Muslime das entscheidende Ereignis, auf das die gesamte Weltgeschichte zuläuft. Der Glaube an die Auferstehung der Toten und das Gericht Gottes über die Taten der Menschen gehört zu den grundlegenden islamischen Glaubensverpflichtungen. "Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und Gutes tut, (alle diese) erhalten ihren Lohn bei ihrem Herrn, sie haben nichts zu befürchten, und sie werden nicht traurig sein." (Sure 2, 62) Wer den "jüngsten Tag" leugnet, gehört zu den Ungläubigen.
Besonders in der Anfangszeit seines Auftretens hat Mohammed mit aufrüttelnden Worten das Gericht Gottes angekündigt, vor der "nahen" Abrechnung (Sure 53,57) gewarnt und seinen Zuhörern Höllenfeuer und Paradies in leuchtenden Farben vor Augen gemalt.
Allerdings finden wir im Koran zwar eine Beschreibung vom Tag des Gerichts und seinen Begleiterscheinungen (vgl. u.a. Sure 99 und 101), jedoch keine ausführlichen Prophezeiungen über den Verlauf der endzeitlichen Geschichte. Weit mehr Material zu diesem Thema enthalten die Hadithen, kurze Berichte über Aussagen und Handlungsweisen Mohammeds, die nach seinem Tod weitererzählt und gesammelt wurden. Da jedoch im Islam die Zuverlässigkeit der einzelnen Hadithe umstritten ist, gibt es auch kein einheitliches Bild der "Endzeit".
Ein Schema über die Reihenfolge der endzeitlichen Geschehnisse bezieht sich auf einen Hadith, der besagt: "Der jüngste Tag wird nicht hereinbrechen, bevor ihr die zehn Zeichen dafür gesehen habt." Dort werden dann die folgenden Ereignisse genannt:
1. Duchan - ein großer Rauch wird die ganze Erde überziehen (Sure 44,10+11). Dieses Ereignis wird vierzig Tage lang andauern.
2. Dadschal - ein Betrüger wird sich zum Gott erklären und fast alle Menschen verführen, obwohl er an seiner Stirn die untilgbare Schrift "Kafir", Ungläubiger, trägt und sein rechtes Auge einer "heraushängenden Weintraube" gleicht.
3. `Isa (islamischer Name für Jesus) - wird wiederkommen. Der Islam lehrt, dass Jesus nicht am Kreuz starb, sondern von Gott zu sich in den Himmel erhoben wurde. Nach dem Koran ist Jesus "ein Erkennungszeichen des Jüngsten Tages" (Sure 43,61). - Mohammed soll gesagt haben: "`Isa, der Sohn der Maryam, wird bald als gerechter Richter kommen, das Kreuz zerbrechen, das Schwein töten, die Kopfsteuer abschaffen..." Außerdem werde er Kirchen und Synagogen in Trümmer legen und alle Christen, die den wahren Glauben, d.h. den Islam, nicht annehmen wollen, niedermachen. Andere Überlieferungen besagen, dass er auf ein Minarett östlich von Damaskus herabsteigen und den Dadschal töten werde. - Er soll durch sein Gebet auch dem folgenden Vorzeichen des nahenden Gerichts ein Ende bereiten:
4. Gog und Magog - zwei Völker unbestimmter Herkunft werden sich über die Erde verbreiten und eine Zeitlang in ihrer Umgebung Unheil anrichten (Sure 21,96).
5. Ein Tier aus der Erde - wird den Menschen ihren Unglauben vorwerfen (Sure 27,82).
6. Die Sonne wird im Westen aufgehen.
7. In der Gegend des Hedschas (in Arabien) wird ein großes Feuer ausbrechen.
8., 9. und 10. Drei große Bodensenkungen werden sich ereignen - eine im Osten, eine im Westen und eine auf der arabischen Halbinsel.
Andere Überlieferungen nennen weitere Personen (z.B. den Mahdi, der z.T. mit Jesus gleichgesetzt wird) und Ereignisse, durch die das nahe Ende der Geschichte angekündigt wird: "Dass das Wissen verschwindet und Unwissenheit herrscht, dass verschiedene alkoholische Getränke zu sich genommen werden und der Ehebruch öffentlich begangen wird, sind gewiß Zeichen des jüngsten Tages."
Auch folgender Ausspruch wird Mohammed zugeschrieben: "Zählt sechs Zeichen, die sich ereignen, bevor der jüngste Tag hereinbricht:
1. Mein Tod.
2. Die Eroberung von Quds (Jerusalem).
3. Verfall der Menschen durch eine Krankheit, die der Schafspest ähnelt.
4. Überfluss an Hab und Gut. Wenn einem hundert Goldstücke gegeben werden, und er zürnt, weil er es als gering ansieht und damit nicht zufrieden ist.
5. Die Ausweitung eines Unfriedens, der ohne Ausnahme in jedem arabischen Haus herrschen wird.
6. Dass zwischen euch und der gelben Rasse ein Friedensabkommen geschlossen wird, dass sie diesen Frieden brechen und mit achtzig Bannern (in jedem davon sind zwölftausend Soldaten) zu euch kommen und euch angreifen."
Bei unterschiedlichen Muslimen, z.B. bei Sunniten und Schiiten, begegnen wir unterschiedlichen Vorstellungen vom Ablauf der Ereignisse vor dem Tag des Gerichts. Die große, allen gemeinsame Perspektive ist die Erwartung des jüngsten Gerichts und der Wiederkunft Jesu als eines wichtigen Vorzeichens.
Was in den islamischen Endzeiterwartungen nicht vorkommt, ist die Entrückung der Gemeinde Jesu und das Kommen Jesu als Messias Israels. Jesus ist im Islam auch nicht der, dem der Vater alles Gericht übergeben hat (Joh. 5,22; Apg. 17,31). - Auch wenn der Islam von der Wiederkunft Jesu spricht: es ist ein anderer Christus, der erwartet wird.
www.orientdienst.de
Aleviten der Türkei
Während die Mehrheit der türkischen Bevölkerung dem sunnitisch-orthodoxen Islam angehört, sind nach Schätzungen bis zu 30% Aleviten. Unter den Menschen türkischer Herkunft in Deutschland liegt dieser Anteil vermutlich sogar noch höher. Viele Kurden aus der Türkei sind Aleviten. Es gibt jedoch auch sunnitische Kurden und alevitische Türken.
Aleviten führen sich auf Ali, den Schwiegersohn Mohammeds zurück. In der Verehrung Alis stimmen sie mit einer großen Hauptrichtung im Islam, der Schia, überein.
Eine weitere Quelle des Alevismus ist der Batinismus, eine Bewegung, die schon in der Frühgeschichte des Islam für eine mystische und gesetzeslose Beziehung zu Allah warb.
Seine besondere Prägung erhielt der alevitische Glaube allerdings erst unter den Türken in Anatolien. Einige der türkischen Stämme, die ab dem 11. Jahrhundert von der mongolischen Steppe her nach Anatolien einfielen, lernten auf ihrem Weg den Islam in seiner batinistisch-gesetzeslosen Form kennen. Im Laufe der Zeit wurden mit diesem Glauben Elemente des Schamanismus der Turkvölker verschmolzen. Die herausragende Figur des anotolischen Alevismus wurde Hadschi Bektasch Veli (ca. 1248 - 1337), dem in der Überlieferung große Gelehrsamkeit und Wunderkräfte zugeschrieben werden. Bektaschismus und Alevismus sind seitdem fast gleichzusetzen.
Laut alevitischer Lehre ist Gott nicht fern. Er lebt im sogenannten "perfekten Menschen" - besonders war das der Fall bei Ali, aber auch bei Jesus, Mohammed und anderen. Der "perfekte Mensch" wird als geradezu göttlich angesehen. Weil er selbst Gut und Böse erkennen kann, sind äußere Gesetze oder religiöse Bücher unbedeutend. Da Gott im Menschen ist, besteht Gebet in erster Linie im Nachdenken über sich selbst. Statt ritueller Gebete in der Moschee trifft man sich zu Gemeinschaftsversammlungen (Dschem), bei denen Tanz, Musik und religiöse Erzählungen im Vordergrund stehen. Männer und Frauen nehmen gleichberechtigt daran teil.
Aleviten haben im osmanischen Reich eine sehr wechselhafte Rolle gespielt. Oft erlebten sie jedoch Feindschaft und Unterdrückung seitens der sunnitisch-orthodoxen Muslime. So ist es zu verstehen, dass Aleviten die Politik Atatürks begrüßten, der nach dem ersten Weltkrieg die Verwestlichung der Türkei auf Kosten des Islam einleitete. Als Reaktion auf das Erstarken des Islam nach Atatürks Tod, wandten sich viele junge Aleviten sozialistischen Parteien zu. Erst nach dem Zerbruch des russischen Sozialismus und dem Aufkommen des fundamentalistischen Islam besinnen sich Aleviten wieder stärker auf ihre religiösen Wurzeln. Für die meisten ist jedoch Alevismus heute mehr eine Lebensphilosophie als eine Religion.
Die schlimmen Erfahrungen mit sunnitischen Muslimen und die eigene religiöse Leere führen dazu, dass manche Aleviten in Deutschland sich dem Christentum, besonders dem weniger gesetzesbetonten Glauben der Protestanten, nahe fühlen. Die Betonung der Liebe, Jesu Erbarmen auch gegenüber Armen und Geringen sprechen sie an. Sie werden in der Regel schnell bejahen, dass der Mensch nicht durch Gesetzeserfüllung, sondern durch eine vertraute Beziehung Gott nahe kommt.
Auch wenn wir bei alevitischen Freunden also weniger negative Vorurteile über das Evangelium erwarten müssen als bei Sunniten, wäre es ein Irrtum anzunehmen, der Schritt zur Erlösung sei für sie natürlich. Dass Gott heilig ist und ein Recht hätte, uns für unsere Sünden zu strafen, ist der alevitischen Glaubensvorstellung fern. Manche Aleviten können leicht "Ja zu Jesus" sagen. Weil sie ihre Erlösungsbedürftigkeit nicht sehen, fällt es ihnen jedoch schwer, Jesus als den einzigen Weg zu Gott zu akzeptieren.
So sind wir auch bei Aleviten auf ein tiefgehendes Wirken des Heiligen Geistes angewiesen, der sie von ihrer Sündhaftigkeit überzeugt und ihnen die Herrlichkeit Jesu zeigt.
www.orientdienst.de
"Schutzbefohlene" - Christen und Juden unter islamischer Herrschaft
Muslime rühmen oft die Toleranz des Islam und berufen sich dabei auf Sure 2, 256: "In der Religion gibt es keinen Zwang."
In der Tat: wenn muslimische Heere Gebiete eroberten, in denen Christen, Juden oder Zarathustra-Anhänger lebten, wurden diese nicht gezwungen, den Islam anzunehmen, sondern konnten auch unter islamischer Herrschaft ihre Religion beibehalten.
Allerdings haben diese religiösen Gruppen nach traditionellem islamischem Recht in einem islamischen Staat nicht die gleichen Rechte wie die Muslime. Sie gelten als "Schutzbefohlene" oder "Schutzberechtigte" (Ahlu-dh-Dhimma), d.h. dass Muslime ihnen unter bestimmten Bedingungen Schutz für ihr Leben und ihren Besitz garantieren und gewisse Freiheiten gewähren dürfen. Auf islamischer Seite ist nur der jeweilige Herrscher berechtigt, den entsprechenden Schutzvertrag abzuschließen.
Der Koranvers, auf den sich diese Regelung im wesentlichen stützt, steht in Sure 9,29: "Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und den Jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, und nicht der wahren Religion angehören - von denen, die die Schrift erhalten haben - bis sie, sich erniedrigend, Tribut entrichten."
Gegen die Götzendiener (Polytheisten) sollen die Muslime nach Sure 9,5 allerdings so lange kämpfen, bis jene getötet werden oder sich zum Islam bekehren.
Erniedrigung
Solange die "Schutzbefohlenen" nicht bereit sind, den Islam, die beste Religion (Sure 3,19 und 3,110) anzunehmen, muss ihnen ihre Unterlegenheit und die Minderwertigkeit ihres Glaubens immer wieder vor Augen geführt werden. Den Nichtmuslimen soll ein Leben im Rahmen der islamischen Gesellschaft ermöglicht werden, damit sie schließlich die Vorzüge der Scharia erkennen und sich zum Islam bekehren.
Weder aus dem Koran noch aus dem Beispiel Mohammeds oder der ersten Kalifen lassen sich völlig einheitliche Bestimmungen für den Umgang mit den "Schutzbefohlenen" ableiten. Deshalb können hier nur einige Regeln skizziert werden, die je nach Situation und Land stark abgewandelt werden konnten.
Der "Schutzvertrag" soll für die ganze Lebenszeit gelten. "Schutzbefohlener" (Dhimmi) kann jeder erwachsene, freie Angehörige einer Buchreligion sein, der Verstand besitzt, zum Kampf fähig ist und die Kopfsteuer (Dschisya) zu zahlen vermag. Kinder, Frauen, arbeitsunfähige Männer und Personen, die kein Einkommen haben, brauchen keine Kopfsteuer zu bezahlen. Die Kopfsteuer war je nach Epoche oder Gebiet unterschiedlich hoch. Sie konnte allerdings zu manchen Zeiten als so belastend empfunden werden, dass "Schutzbefohlene" es vorzogen, den Islam anzunehmen, um von der Kopfsteuer befreit zu werden.
Die Gesetze, die den Dhimmi-Status definieren, zielen darauf ab, es den unterworfenen Anhängern anderer Religionen unmöglich zu machen, den Aufbau der islamischen Gesellschaft in irgendeiner Form zu behindern oder gar zu gefährden.
Verbote und Einschränkungen
So ist es nach islamischem Gesetz den "Schutzbefohlenen" verboten, den Koran, Mohammed oder den Islam zu kritisieren (vgl. das Blasphemiegesetz in Pakistan), einen Muslim in bezug auf seine Religion zu verwirren oder die Feinde der islamischen Welt zu unterstützen. Sie dürfen keine Positionen einnehmen, in denen sie über Muslimen stehen könnten, besonders in der Regierung, im Richteramt (für das der Islam die wichtigste Voraussetzung ist), im Militär oder als Polizisten. (Allerdings werden von einigen Rechtsgelehrten den "Schutzbefohlene" eigene Richter für die Regelung "innerer Angelegenheiten" zugestanden.)
Wenn sie auch nicht gezwungen werden, den Islam anzunehmen, sollen sie jedoch (vor allem in den Städten) daran gehindert werden, die Kennzeichen ihres Glaubens zu zeigen, weil im Herrschaftsbereich des Islam keine Kennzeichen des Unglaubens geduldet werden sollen. In manchen Gegenden war und ist es jedoch Christen erlaubt, ihre Kreuze zu zeigen, Glocken zu läuten und Kirchen oder Klöster zu bauen, in anderen war und ist es ihnen verboten.
Auch hinsichtlich Kleidung und Kopfbedeckung sollten sich (z.T. bis heute) die Angehörigen anderer Religionen von den Muslimen unterscheiden - damit sowohl ihr Ungehorsam gegenüber dem Islam als auch ihre Erniedrigung offen sichtbar werden. Zeitweilig sollten Christen und Juden sich durch die Farbe ihres Gürtels als Nichtmuslime zu erkennen geben.
Freiheiten
Der Genuss von Wein und Schweinefleisch soll den "Schutzbefohlenen" (straffrei) erlaubt sein. Allerdings wird ihnen in der Regel verboten, Wein und Schweine in der islamischen Öffentlichkeit sehen zu lassen. Im Übrigen sollen sie jedoch - wie die Muslime - dem islamischen Strafrecht unterworfen sein.
Das islamische Recht gesteht den "Schutzbefohlenen" prinzipiell ihr eigenes Eherecht zu. Streit gibt es über die Fragen, wie zu verfahren sei, wenn ein Dhimmi zum Islam übertritt, wenn Angehörige verschiedener nicht-islamischer Religionen heiraten wollen bzw. welcher Religion die aus einer solchen Ehe hervorgehenden Kinder angehören sollen. Auch im Rahmen des Erbrechts wird den "Schutzbefohlene" eine gewisse Eigenständigkeit gewährt.
Selbst wenn den "Schutzbefohlenen" also innerhalb der islamischen Gesellschaft (in einem sehr eingeschränkten Rahmen) "Religionsfreiheit" und die interne Regelung einiger rechtlicher Fragen zugestanden wird, sind sie im Grunde doch "Bürger zweiter Klasse" und mancherlei Diskriminierungen ausgesetzt.
Literatur: Ishak Ersen, Die Rechte und Pflichten der Juden und Christen in einem islamischen Staat, Licht des Lebens, Villach, Österreich, 1992
www.orientdienst.de
Fasten
Das Fasten im Monat Ramadan gehört zu den "5 Säulen" des Islam. Es ist für jeden erwachsenen Muslim "unbedingt geboten". Allen, die das Fastengebot bewusst übertreten, wird Strafe angedroht - sofern sie nicht eine der im Koran genannten Ausnahmeregelungen für sich in Anspruch nehmen können.
Das arabische Wort "sawm" hat die Grundbedeutung: "sich enthalten" - z.B. vom Reden, Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr.
Schon vor dem Auftreten Mohammeds war auf der arabischen Halbinsel das Fasten als religiöse Praxis bekannt. Mohammed selber hat sich bereits vor seiner Berufung zum "Propheten" zu Fasten und Meditation in die Wüste zurückgezogen.
Als Pflicht für die Muslime wurde das Fasten erst in Medina eingeführt. Dort kamen Mohammed und seine Anhänger in Kontakt mit Juden; Mohammed war sehr interessiert an einem Bündnis mit ihnen gegen die Mekkaner. Um die Juden zu gewinnen, hielten er und die Muslime u.a. mit ihnen das Aschura-Fasten (das Fasten am Versöhnungstag - vgl. 3. Mose 16) ein. Die Juden ließen sich jedoch nicht für ein Bündnis gewinnen. Nach der Schlacht bei Badr, in der Mohammed einen entscheidenden Sieg über die Mekkaner errungen hatte, brauchte er die Juden nicht mehr; das Fasten wurde nun bezogen auf die Herabsendung des Koran (Sure 2,185).
Der Fastenmonat Ramadan
In der 27. Nacht des Monats Ramadan (lailat al-qadr - "Nacht der Macht"; vgl. Sure 97 und 44,3) soll Mohammed seine erste Offenbarung (Sure 96,1-5) durch den Engel Gabriel empfangen haben. So wurde der Monat Ramadan, der 9. Monat des muslimischen Mondjahres, zur vorgeschriebenen Fastenzeit.
Das Fasten beginnt mit dem Tag, an dem die Mondsichel neu am Himmel erscheint; nach etwa 30 Tage, mit erneutem Sichtbarwerden der Mondsichel, ist der Fastenmonat zu Ende. Es folgt das Fest des Fastenbrechens (`id al-fitr, auch "kleines Fest" oder "Zucker-Fest" - Türkisch: Seker Beyram). - Da die Mondmonate kürzer sind als die Monate im Sonnenjahr, wandert der Ramadan in 34 Jahren einmal durch alle Jahreszeiten.
Fastenpraxis im Monat Ramadan
Die Grundlage für die islamische Fastenpraxis findet sich vor allem in Sure 2,183-187. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang (solange man einen weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden kann - Sure 2,187) müssen Muslime sich enthalten von Essen und Trinken und Geschlechtsverkehr; auch das Ausspülen des Mundes mit Wasser und das Rauchen, nach manchen Theologen sogar das Schlucken des Speichels sind verboten.
Damit das Fasten als gültig anerkannt wird, muss zu Beginn eine Absichtserklärung zur Einhaltung des Fastens ausgesprochen werden - wobei umstritten ist ob nur am Anfang des Fastenmonats oder täglich.
In der islamischen Welt hat das Fasten im Ramadan starke Auswirkungen auf den gesamten Tagesrhythmus. Tagsüber wird weniger gearbeitet; die Ämter schließen früher. Das Leben verlagert sich mehr in die Nächte, in denen ausgiebig gegessen und getrunken wird. (In der Regel wird im Ramadan mehr Geld für Lebensmittel ausgegeben als in anderen Monaten).
Ausnahmen und Ersatzleistungen
Vom Fasten entbunden sind Kinder, Kranke, Schwangere, Stillende, Greise, Schwerstarbeiter u.a., die durch das Fasten an Gesundheit und Leben Schaden nehmen würden. Auch Reisende müssen nicht fasten. Den Frauen ist während ihrer Periode ("Unreinheit") das Fasten verboten. - Erwachsene müssen die entsprechende Anzahl von Tagen möglichst bald nachholen. Es wird allerdings auch die Möglichkeit eingeräumt, das Fasten durch die Speisung eines Bedürftigen (Sure 2, 184) u.ä. abzugelten.
Allah macht es niemandem zu schwer (Sure 2, 185). Wer jedoch das Fasten absichtlich bricht, muss ein 60-tägiges Sühnefasten ableisten, einen Sklaven loskaufen oder große Almosen geben. Wer stirbt, während er noch eine gewisse Zeit fasten müsste, für den soll ein naher Verwandter das Fasten leisten.
Zusätzliche Fastenzeiten
Als Strafen für bestimmte Sünden können zusätzliche Fastentage (Bußfasten) angeordnet werden (vgl. Sure 5,98). Für Muslime, die besonders fromm sein oder schlechte Taten ausgleichen möchten, gibt es die Möglichkeit, freiwillig zusätzliche Fastenzeiten auf sich zu nehmen; dies ist "wünschenswert" und gilt als verdienstliches Werk. Empfohlen wird ein zusätzliches Fasten z.B. für den Aschura-Tag oder für sechs Tage des Monats Shawwal, der auf den Ramadan folgt. - An Feiertagen ist das Fasten jedoch verpönt, am Fest des Fastenbrechens und am Opferfest ist es sogar verboten.
Erwartungen, die mit dem Fasten verbunden sind
Ein rein äußerliches Fasten reicht nicht. "Wenn jemand nicht unterlässt, das Falsche zu bezeugen und es zu tun, so liegt Gott nichts daran, dass er vom Essen und Trinken absteht." (Hadith) - Die Fastenzeit soll der religiösen Erneuerung dienen. Sie soll den Muslimen helfen, sich nicht zu sehr an die vergängliche Welt und die körperlichen Bedürfnisse zu binden. Manche erwarten sich vom Fasten eine Reinigung der Seele und Kraft, die Sünde zu besiegen. Im Ramadan werden zudem in besonderer Weise Koranrezitationen dargeboten, und man trifft sich zu nächtlichen Gebetszeiten (tarawih) in den Moscheen.
Muslime hoffen, dass sie sich durch das Fasten große Verdienste erwerben und dass es zur Tilgung ihrer Sünden dient. - Das bleibt allerdings eine vage Hoffnung. Denn Gott ist völlig frei in seinem Richten oder Vergeben.
Letztlich ist das Fasten schlicht eine Pflichterfüllung: Es wird gefastet, weil Gott es so will!
|
|