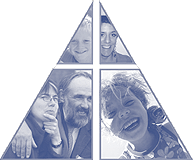André Golob

Anmeldedatum: 21.10.2006
Beiträge: 129
Wohnort (nur bei Vollmitgliedschaft erforderlich ): 46236 Bottrop
|
 Verfasst am: 11.06.2007, 09:22 Titel: Joh 20, 19-31: Der gläubige Thomas Verfasst am: 11.06.2007, 09:22 Titel: Joh 20, 19-31: Der gläubige Thomas |
 |
|
Eucharistiefeier am Weißen Sonntag im Lesejahr C
alt-kath. Gemeinde Bottrop, 15.04.07, 10.00 Uhr
Kreuzkampkapelle
Leitung und Predigt: Vikar Dr. André Golob
Joh 20, 19-31 Der gläubige Thomas
Im heutigen Evangelium steht ein besonderer Mann im Mittelpunkt: Der Apostel Thomas – auch „Didymus“ genannt, was auf Griechisch soviel heißt wie „Zwilling“. Viele Geschichten ranken sich um diesen Mann. Jesus soll ihn noch zu Lebzeiten den Auftrag gegeben haben die Frohe Botschaft in den Osten zu bringen und in der Tat fanden die portugiesischen Eroberer, als sie in Indien einfielen, zu ihrer Überraschung christliche Gemeinden. Thomaschristen nennen sich die Christen Indiens. Das Requiem zum Tode meines Vaters wurde vom einem solchen Thomaschristen gehalten. Er sprach den Schlußsegen in der liturgischen Sprache der Thomaschristen, nämlich auf Aramäisch, der Sprache die Jesus selbst gesprochen hat.
Manch Wissenschaftler sehen in Thomas den Verfasser des sogenannten Thomasevangeliums, eines apokryphen Evangeliums, das man zunächst bruchstückhaft in Oxyrhynchos in Ägypten und später bei den Ausgrabungen in Nag Hammadi in Syrien vollständig gefunden hat. „Spalte ein Stück Holz, hebe einen Stein auf und du wirst Gott darunter finden“, so der berühmteste Spruch – der 77ste - des Thomasevangeliums, einem Evangelium das uns zeigt, daß wir Menschen auch ohne Zwischenschaltung einer kirchlichen Instanz Gott begegnen können.
Eine schillernde Gestalt dieser Thomas. Möglicherweise eine Jünger Jesu, der seinem engsten Kreis angehörte. Ein Eingeweihter, einer der vieles nachvollziehen konnte, vieles verstand, was andere nicht verstanden, jemand der Jesus sehr nahe gestanden haben muß. Manch Theologen glauben gerade deshalb trug er den Namen „Didymus“ - Zwilling - weil er Jesus so ähnlich war. Vieles bleibt im Dunkeln. Viele Fragen zu Thomas bleiben zwar nicht unbeantwortet; welche Antwort jedoch die richtige ist – wer mag es wissen?
Thomas war wohl ein bedeutender Apostel, ein Wissender – trotzdem wird er stets als der Zweifler genannt, als ungläubiger Thomas – mit Blick auf das heutige Evangelium – irgendwie ungerecht. Meine alte Gemeinde in Düsseldorf hat sich den Namen Thomasgemeinde gegeben, auch die Kirche dort heißt jetzt Thomaskirche. Das hat seinen Grund. Der Gemeinde war bewußt wie wichtig es ist zu zweifeln, infrage zu stellen, Skeptiker zu sein. Sie hat erkannt, das eigentlich wahrer Glaube nur auf Zweifeln gründen kann. Glaube unberührt von Kämpfen des Zweifelns und des Ringens, ist fade, erscheint andressiert, ankonditioniert. Wir sind Menschen die denken können, Menschen denen Gott Vernunft und Intelligenz geschenkt hat, keine Nachplapperer oktroyierter Lehrsätze. Zweifler zu sein ist vielleicht doch nicht so negativ.
Und es geht bei Thomas um eine Erfahrung besonderer Art. Es geht um den Weg und die Entwicklung vom Trauern zum Vertrauen. Stellen wir uns vor: Da steht auf der einen Seite eine Gruppe von Jüngern, die völlig davon überzeugt sind, Jesus, den Auferstandenen, gesehen zu haben, und die darin ihre Freude, ihren Glaubensinhalt, ihre Sehnsucht und Energie zum Leben setzen. Alles was sie sind, gründet sich in dieser neugeschenkten Überzeugung. Aber dann kommt von der anderen Seite ein Einzelner, der sagt: `so will ich das nicht! Nur weil ihr etwas behauptet, glaube ich es noch lange nicht´. Dabei sollte man in den Zweifeln des Thomas den Frage- und Klageruf einer ganzen Menschheit vernehmen. Hat es denn das nicht viel zu oft schon gegeben, daß da ein Kreis von Schwärmern sich einfach hinwegtrösten mochte über das Leid? Auch die Phrasen und Beschwichtigungsformeln, die dann gebraucht werden – und wir alle kennen sie – sind immer die gleichen: „Die Zeit heilt alle Wunden“ oder „Das Leben geht weiter“ oder „Man darf den Kopf nicht hängen lassen“ oder „Es ist morgen auch noch ein Tag“. Sprüche, die ich auch aus Hausbesuchen bei trauernden Menschen kennen. Sprüche mit denen die guten Nachbarn die Stimmung aufheitern wollen, damit ihnen der Kuchen nicht quer runtergeht. In all diesen Wendungen versucht man, den Schmerz des Augenblicks hinwegzustreichen, hinwegzustreicheln bestenfalls. Es ist wohl niemals böse gemeint, und doch kann es weh tun, weil der Abstand unter den Menschen gerade in diesen Worten nur weiter wächst. Da verläuft eine neue Trennlinie zwischen denen, die schon wieder Tritt gefaßt haben, und denen, die nicht mehr mitkommen. Da sind die einen schon wieder arriviert, mittendrin im pulsierenden Leben, mit aufgekrempelten Ärmeln, voll dabei – und die anderen verabschieden sich beinahe auf der Rückseite des so schöngeredeten Lebens. Sie können nicht mitmarschieren, sie treten auf der Stelle, sie schauen ständig nach rückwärts, sie kommen nicht los von der Vergangenheit, von den Erinnerungen – noch nicht. Es ist der Skeptizismus, der Pessimismus, vielleicht aber auch nur die Ehrlichkeit des Thomas, sich nicht ein X für ein U vormachen zu lassen. Glauben, das bedeutet für ihn, eine persönliche Erfahrung einzulösen. Religion ist für ihn nicht das, was andere ihm vorsetzen, auch wenn sie selbst noch so glücklich dabei sind. Er erwartet, über den eigenen Schmerz hinweggehoben zu werden durch etwas, das sich wirklich erfahren läßt. Dieses etwas läßt sich indessen weder befehlen noch hervorzaubern noch herbeizwingen. Entweder es gestaltet sich wie ein Wunder aus den Händen Gottes, oder es geschieht nie. Und je nachdem, ob ein Mensch es persönlich so erfährt oder eben nicht erfährt, bleibt er im Bann der Trauer wie hypnotisiert oder es dringt ein Schimmer von Licht und Friede in den Kerker seiner Seele.
So ist es mit Thomas, so soll es mit uns sein. Und nie, an keiner Stelle der Frohen Botschaft wird ein solches Verhalten, Zweifel und der Wunsch nach Erfahrung des Geglaubten, verurteilt. Eine Gemeinschaft, die sich aus dem Geiste Jesu Christi formte, schlösse niemanden aus. Im Gegenteil, da wäre es möglich, ja geradezu gefordert, daß jemand sich kategorisch weigerte, von den anderen eine ihm selber fremde Erfahrung zu übernehmen, und nachzureden.
Uns bleibt die Frage, wie wir Menschen unterstützen können auf der Suche nach Erkenntnis, auf dem Weg vom Trauern zum Vertrauen. Hier gibt es keine Geheimrezepte, hier geht jeder Ratschlag daneben. Besser ist es einfach da zu sein, wenn erwünscht, und zuzuhören – und: ehrlich zu sein, auch den Mut zu haben Unbequemes zu sagen, sich dem Leid zu stellen. Das Trauern zu besiegen, so zeigt uns das heutige Evangelium, bedeutet nicht zu verdrängen und so dem Leid aus dem Weg zu gehen. Es heißt vielmehr sich dem Leid zu stellen, die Finger in die Wunde zu legen - so schmerzhaft es ist - und all das Leid zu verarbeiten und umzuformen zu neuem Leben und Hoffnung. Das ist wahrer Glaube. Und diesen Glauben findet Thomas. Er nimmt nicht an, was andere ihm vorsetzen, er übernimmt die Eigeninitiative im Wissen darum, das Glaube erfahrbar ist, das Gott erfahrbar ist. Am Schluß, so erscheint es uns, hat Thomas den Glauben eingetauscht gegen etwas, das man Wissen nennen kann. Das gibt es: daß Glaube umgeformt werden kann in Wissen. Durch die Berührung, die Begegnung mit Gott, vielleicht beim Aufheben eines Steines oder dem Spalten eines Holzes, oder dem Lächeln eines Kindes, oder wo auch immer Gott sich offenbart. Glaube wird durch Erfahrung zu Wissen. In diesem Sinne paßt es dann wieder, das Wort vom ungläubigen Thomas – ein Vorbild für uns alle.
Amen |
|