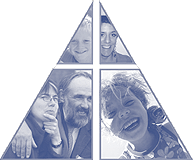André Golob

Anmeldedatum: 21.10.2006
Beiträge: 129
Wohnort (nur bei Vollmitgliedschaft erforderlich ): 46236 Bottrop
|
 Verfasst am: 16.07.2007, 22:24 Titel: Joseph Beuys „Stuttgarter Kreuzigung“ Verfasst am: 16.07.2007, 22:24 Titel: Joseph Beuys „Stuttgarter Kreuzigung“ |
 |
|
Joseph Beuys „Stuttgarter Kreuzigung“
Bekenntnis eines Künstlers und Mystikers
Religiöse Kunst hat es zu allen Zeiten und in allen Kulturen gegeben. Nicht wenigen Manifestationen religiöser Ästhetik geht es um die Darstellung von Wahrheit, um das Erscheinen einer ausgezeichneten Wirklichkeit. Nicht photorealistische Abbildung und vordergründiger Augenschmaus stehen im Zentrum einer solchen Kunst; vielmehr trägt sie einen spirituellen Anknüpfpunkt, einen Erkenntnis-, ja Offenbarungsaspekt in sich. Gerade christliche Künstler gestalten ihre Kunst im Kontext eigener Glaubenserfahrung und möchten davon Kunde geben.
Das theologische Prinzip der „Ecclesia semper reformanda“ bereitet auch den Platz für eine „ars moderna“, eine zeitgenössische christliche Kunst. Meist ist dieser Platz aber bereits belegt. Unsere Gotteshäuser scheinen zu Museen geworden zu sein, zu Pilgerstätten für Touristen und Kunstliebhaber des Barocken, Romanischen oder Gotischen. Werke von Gegenwartkünstlern sucht der Kirchenbesucher hier vergeblich. So findet sich zeitgenössische religiöse Kunst, wie die Skulptur „Kreuzigung“ (1962/63) des niedrrheinischen Künstlers Joseph Beuys (1921-1986), in Museen wie der Stuttgarter Staatsgalerie - ein Widerspruch in sich. Jener Beuys, seines Zeichens Professor und entfant terrible der Kunstakademie Düsseldorf - der Öffentlichkeit durch die Verwendung ungewöhnlicher Materialien wie Fett und Filz bekannt - verstand sich selbst als christlicher Künstler und mehr. Viele seiner Werke erweisen ihn als Menschen mit spiritueller Tiefe und laden ein zur Reflektion und Meditation.
Die Skulptur
Auf den ersten Blick wird sich der Durchschnittsbürger wohl verständnislos, vielleicht sogar kopfschüttelnd, abwenden. Doch auf den zweiten Blick erweist sich die „Stuttgarter Kreuzigung“ als Kunstwerk mit Tiefgang. Der 1986 verstorbene Künstler mit dem grauen Filzhut - seinem Markenzeichen - trat ins Bewußtsein der Öffentlichkeit mit gewollt provozierenden Skulpturen. Honigpumpe, Fettecke oder die Zinkwanne, um die sich eine Menge urbaner Mythen ranken, standen im Zentrum der Medienberichterstattung. Wenigen ist bekannt, dass Joseph Beuys ein zutiefst religiöser Künstler war und seine Kunst aus einem spirituellen Impetus heraus schuf. Besonders das Kreuz spielte im Leben des Joseph Beuys von Anfang an eine wichtige Rolle. Darstellungen der Kreuzigung oder des Kruzifixes gehören jedoch seiner Frühphase an und tauchen in seinen späteren Werken kaum noch auf. Wir werden sehen warum. In den Sechziger Jahren schuf Beuys die Kreuzigungsgruppe, die entgegen der gewohnten Mitteln der religiösen Darstellung auf gänzlich andere Medien zurückgreift. Trotz der unorthodoxen Wahl der Mittel scheint es als erkenne man bereits von weitem worum es geht. Der Titel „Kreuzigung“ bestätigt dann auch schnell den ersten Eindruck; ebenso wie die Information, dass Beuys selbst die beiden „Gestalten“ als Maria und Johannes bezeichnet. Aber auf welche Art und Weise ist hier das Kreuzigungsthema vergegenwärtigt? Statt des Kreuzes ein senkrechter Balken, an dessen oberem Ende ein bedruckter Zettel, übermalt mit einem Kreuz, befestigt ist. Das Kreuz mag zunächst an das Rote Kreuz erinnern, doch bei genauem Hinschauen erweist es sich als das Braunkreuz, das im Werk des Künstlers sehr häufig erscheint. An den Balken ist mit einem alten Kabel eine Latte gebunden. Vor diesem stehen zwei Plastikflaschen wie man sie für Blutkonserven verwendet, auf ihren Verschlüssen sind nochmals bedruckte Zettel mit dem Braunkreuz. Das ganze steht auf zwei weiß verschmierten Balken, von denen jeder an der linken Seite einen deutlichen Einschnitt hat. Ist hier etwa an die Seitenwunde Christi gedacht? Gemein ist allen diesen Dingen, dass sie ganz ärmlich, von früherem Gebrauch abgenutzt sind.
Mystische Annährung an das „Spirituelle Ganze“
Und dennoch besteht jener erste Eindruck von einer Kreuzigung fort, auch ohne die Bestätigung durch den Titel. Die Wirkung, nicht die Bezeichnung entscheidet. Die beiden Flaschen haben eine eigentümlich Verwandlung durchgemacht, sie sind Medium, künstlerisches Mittel geworden, kaum anders als das Zirbenholz oder der Stein einer alten Heiligenfigur oder auch die Farbe in einem Gemälde. Aus der Nähe gesehen scheinen sie uns abgewandt, den Blick aufs Kreuz gerichtet wie jene monumental vereinfachten Rückenfiguren Giottos. Die leichte Schrägstellung der rechten Flasche bringt ein gewisses Leben in die Gruppe. Aber damit ist es auch genug. Beuys erlaubt unserer Wahrnehmung keinen Schritt näher in Richtung auf das Abbildliche zu. Die an den Balken befestigte Latte meint in ihrer Bedeutung wohl den Gekreuzigten, doch ist sie in gar keiner Weise dessen Bild, wie etwa jenes sogenannte Sonnenkreuz von Beuys (1947/48), das gar nicht denkbar ist ohne die berühmten Gabelkruzifixe der Gotik. Von allem Abbildhaften, Ikonischen seiner Frühzeit hat sich Beuys schroff abgewandt. Er selbst hat das in einem Gespräch mit Friedhelm Mennekes sehr deutlich gemacht. Die frühen Kreuzigungsdarstellungen bezeichnet er dort als ersten Versuch, sich an das „Spirituelle Ganze“ von einer Seite „heranzutasten“, die jedoch noch stark von traditionellen Einflüssen geprägt gewesen sei. Doch seien diese Versuche stets klein geblieben, modellhaft, nicht befriedigend ausgeführt. Schon Mitte der fünfziger Jahre erschöpft sich die Versuchsreihe vom traditionellen Motiv her an das Spirituelle heranzukommen. Eine Wende bahnt sich an.
Die Wirklichkeit der Kraft
Die Wende - die Stuttgarter „Kreuzigung“ ist fast ein Jahrzehnt nach ihr entstanden - rührt zweifellos an das Wesen der Beuysschen Kunst, an jenes Verwirrende, Mißverständliche, unsere künstlerischen Sehgewohnheiten Provozierende, das seine Wurzeln letztendlich in einem religiösen Erlebnis hat. In dem erwähnten Gespräch wird er auf überraschende Weise deutlich: “Es wird aufgeräumt“, bemerkt Beuys in Hinblick auf sein späteres Schaffen, „mit einer bestimmten Sicht vom Christentum, als handle es sich um ein wichtiges historisches Ereignis.“ Das Ganze findet in einer Zeit statt, wo vor allem in der praktischen Theologie sehr stark an der Suche nach Entmythologisierung gearbeitet wird. „Ich hab mich stark gegen diese Art sozialdemokratischen Christentums gewandt, ganz gleich ob das Dorothee Sölle war, Karl Barth oder Rudolf Bultmann. Ich habe mich dagegen gewehrt, als handle es sich bei diesem Christus um eine historische Figur.“ Und nach diesen überraschenden Qualifizierungen seiner theologischen Gegner kommt Beuys zu dem, was ihm wesentlich ist: “Mir ging es um die Wirklichkeit dieser Kraft, eine stetig anwesende und sich verstärkende Gegenwart.“ „Joseph Beuys ist ein niederrheinischer Mystiker“, stellt der Feuilletonist und Kunstexperte Otto von Simson fest. „Nicht als historische Figur hat er Christus, schon gar nicht den Gekreuzigten, erlebt, sondern als geheimnisvoll gegenwärtige Wirklichkeit. Damit mußten ihm konsequenterweise alle traditionellen Kreuzigungsdarstellungen eben wegen ihrer Abbildlichkeit als völlig unzulänglich erscheinen“. Aber wie war die „Wirklichkeit dieser Kraft“ - Christus - künstlerisch zu vergegenwärtigen?
Die Stuttgarter „Kreuzigung“ ist die Antwort auf diese Frage. Wir sollen das Erlösungsopfer am Kreuz nicht nur mit den Augen erfassen, sondern mittels eines erweiterten Sinnenbewußtseins.
Das Prinzip der Wandlung
Kreuz und Gekreuzigter sind Holz, greifbar, im Sinne des „lignum vitae“ der Liturgie. Die oben und links unten herausragenden Nägel machen für uns das Leiden als physischen Schmerz spürbar (Stigmata). Die Armseligkeit des Materials ist dem Elend der Passion viel näher als Gold oder Marmor, die frühere Jahrhunderte für Kreuzigungsdarstellungen verwendet hatten. Und immer wieder werden wir auf das Blut gestoßen: Das Braun der drei Kreuze, nicht das Rot, war für Beuys die intensivste Färbung des Blutes. Die Flaschen sollten uns an Blutkonserven erinnern - unwillkürlich denkt man an Paul Gerhardts „Oh Haupt voll Blut und Wunden“. Wird das Verschwinden des Figürlichen, die Abkehr von Abbildhaften, hier nicht ersetzt durch einen Erfahrungsbereich, der unserer Zeit gemäß ist, deren Kunst weitgehend gekennzeichnet ist durch das Verschwinden des Menschenbildes? Man wagt sich nicht recht an die Deutung des so augenfällig über den Balken ragenden Drahtes, an dem eine Nadel hängt. Immerhin: Beuys hat gelegentlich Christus als Erfinder der Elektrizität bezeichnet, also als „Erfinder“ jenes Prinzips der Substanzumwandlung, die physikalisch in der Elektrizität geschieht (Metapher). Naturwissenschaft war für Beuys auch ein theologisches Ereignis; so mag man sich fragen, ob jener Draht nicht ein „naturwissenschaftlicher“ Hinweis auf eucharistische Wandlung und Auferstehung ist. Es liegt nahe.
Die Aussagelosigkeit des Figürlichen
Im Museum ausgestellt ist jedes religiöse Kunstwerk entsakralisiert, säkulares Objekt vornehmlich ästhetischer Betrachtung. Das gilt auch für Stuttgarter „Kreuzigung“ von Joseph Beuys. Aber man kann sich leicht vorstellen, dass sie etwa in einem kirchlichen Raum oder auch in der eigenen Wohnung „unheimlich würde“, dass das Numinose, jene „Gegenwärtigkeit der Kraft“, in unser Bewußtsein treten müßte.
Vor dem Hintergrund mystischer Erfahrung erscheint dem Künstler das rein figürliche Motiv, vor allem die Darstellung des Menschen am Kreuz, zutiefst aussagelos. Jene „Aussagelosigkeit“ hat auch Beuys in seiner künstlerischen Entwicklung erfahren. Man wird das nicht bedauern, so bedeutsam seine früheren - figürlichen - Kruzifixe auch sind, so sehr selbst eine Bleistiftzeichnung wie die „Auferstehung“ von 1951 seine bildnerische Gestaltungskraft bezeugt. Die Stuttgarter „Kreuzigung“ erscheint stärker, dichter und zutiefst von jener Erfahrung geprägt, die Beuys das Trauma des eigenen Lebens wohl auch als Nachfolge Christi verstehen ließ. Man denkt an jenes Photo, das ihn während des „Gemeinschafts-Happenings“ in der Technischen Hochschule Aachen zeigt. Blutend nach einem Faustschlag, der ihn ins Gesicht getroffen hat, hält Beuys ein hölzernes Kruzifix mit einer Geste empor, die wohl nur als Bekenntnis zu verstehen ist.
André Golob |
|