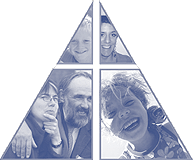| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
André Golob

Anmeldedatum: 21.10.2006
Beiträge: 129
Wohnort (nur bei Vollmitgliedschaft erforderlich ): 46236 Bottrop
|
 Verfasst am: 13.09.2007, 01:18 Titel: Religionen der Welt - Teil 9: Der Lamaismus Verfasst am: 13.09.2007, 01:18 Titel: Religionen der Welt - Teil 9: Der Lamaismus |
 |
|
Wir möchten an dieser Stelle eine Reihe starten mit dem Titel: „Über den Tellerrand geschaut – Religionen der Welt“ Es sollen hier zunächst weniger bekannte oder verbreitete Religionen und Kulturen vorgestellt werden. Denn wer kennt schon den Jainismus, den Taoismus, den Shintoismus oder so etwas wie Macumba. Darstellungen zu den bekannten Hochreligionen wie Buddhismus oder Islam werden diesen folgen. Um der Reihe eine gewisse Spannung zu verleihen, werden die einzelnen Religionen zunächst als Rätsel präsentiert. Wer errät als erster den Namen der gesuchten Religion?
Wir suchen heute ...
eine Religion, dessen bedeutendstes Oberhaupt sogar beim ökumenischen Kirchentag in Berlin ein Forum erhielt. Dieser Religionsführer trägt orangene Gewänder und hat sogar mit Eugen Drewermann gemeinsam Bücher veröffentlicht und zusammen mit Otto Schilly Kongreßhallen zum Bersten gebracht und ihm wurde sogar in der Bild-Zeitung eine eigene Kolumne eingeräumt. Gesucht ist der Name einer asiatischen Religion, der auf ihre religiösen Lehrer und Führer verweist. Eigentlich gehört diese Religion einer großen Weltreligion an, trägt jedoch sehr viele schamanische Elemente in sich. |
|
| Nach oben |
|
 |
André Golob

Anmeldedatum: 21.10.2006
Beiträge: 129
Wohnort (nur bei Vollmitgliedschaft erforderlich ): 46236 Bottrop
|
 Verfasst am: 13.09.2007, 01:21 Titel: Verfasst am: 13.09.2007, 01:21 Titel: |
 |
|
Der Lamaismus -
Buddha als kleiner Zauberer
Buddhismus ist der Oberbegriff für eine Vielzahl von religiösen Richtungen, die sich alle auf die Lehre des Buddha Gotama berufen, einer aus dem Hinduismus erwachsenen Reformbewegung, die sich ein halbes Jahrtausend vor Christus zur eigenständigen Religion formierte. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ausprägungen dieser Religion sind so gravierend, daß es mitunter erscheint, als würde es sich um mehrere Religionen handeln. Im Vergleich dazu sind die Unterschiede zwischen den christlichen Konfessionen zu vernachlässigen. Dieser Artikel möchte jedoch nicht auf die einzelnen Glaubensinhalte des Buddhismus eingehen, sondern zeigen, auf welche Art und Weise diese Religion das indische Mutterland in Richtung Norden verließ.
Ein frommer Wunsch von Prinzessinnen
Eine tibetische Variante des Buddhismus, die besonders durch den 14. Dalai-Lama auch im Westen immer mehr an Bekanntheit gewinnt, ist der sogenannte Lamaismus. Er erhielt seinen Namen von dem Wort „lama“ bzw. „bla-ma“, mit dem ursprünglich nur die höheren, später jedoch alle Geistlichen bezeichnet wurden. Maßgeblich bei der Einführung des Buddhismus war der damalige König Srong-tsan-gampo (Regierungszeit 620-649). Der Anstoß hierzu soll von zwei königlichen Frauen ausgegangen sein, von auswärtigen Prinzessinnen, die der König geheiratet hatte. Es waren Bhrikutī, eine Tochter des nepalesischen Königs, und Wen-ch`ing, eine Nichte des regierenden chinesischen Kaisers. Beide hatten den Wunsch zur Buddhisierung des Landes geäußert.
Die Auseinandersetzung mit der Bon-Religion
Diesen Wunsch erfüllte Srong-tsan-gampo mit der Gründung von buddhistischen Tempeln. Damit wandte sich der König praktisch gegen die bestehende Bon-Religion, die vor Einführung des Buddhismus unumschränkt in Tibet geherrscht hatte. Im Laufe einer rivalisierenden Entwicklung beider Glaubensformen, die sich nunmehr anbahnte, hat das Bontum den Buddhismus nicht unwesentlich beeinflußt und damit seine tibetische Sonderform mitbestimmt. Zunächst dominierte noch die Bon-Religion, die vor allem von Adligen und Staatsbeamten unterstützt wurde. Dieser Zustand eines weiterhin vorherrschenden Bontums dauert an bis zur Regierungszeit des Königs Khri-srong lde-btsan (755-797). Vor seiner Amtszeit hatte dieser von den Ministern, die für ihn die Regierung führten und der Bonreligion angehörten, viele Demütigungen erfahren müssen. Berichte sprechen davon, daß zu jener Zeit die Bon-Priester einige buddhistische Tempel zu Schlachthäusern machten und in ihnen offenbar blutige Bon-Opfer vollzogen. Bevor König Khri-srong lde-btsan den Buddhismus protegieren konnte, mußte er sich des bislang allmächtigen Ministers und Führers der Adelspartei Ma-zhang entledigen. Dies geschah, indem ein Staatsorakel bestellt wurde, das die Notwendigkeit verkündete, der Minister müßte eine Zeitlang in einem unterirdischen Grabraum verweilen. Ma-zhang wurde niemals aus dieser Einmauerung befreit. Damit hatte der König nunmehr freie Hand, aus Indien den berühmten buddhistischen Gelehrten Shāntirakshita ins Land zu rufen. Shāntirakshita kam mit einem großen Stab indischer Gelehrter nach Tibet, um dort das Werk der Übersetzung der heiligen Schriften des Buddhismus ins Tibetische in Angriff zu nehmen. Da jedoch der stille Gelehrte Shāntirakshita dem Widerstand der schamanischen Bon-Priester und der antibuddhistischen Adelspartei nicht gewachsen war, beschloß man, den Buddhismus durch eine tatkräftigere Persönlichkeit zu fördern und den großen indischen Zauberer und Dämonenbeschwörer Padmasambhava nach Tibet zu rufen.
Padmasambhava und die Rotmützen
Padmasambhava soll sich selbst den größten Zauberer und Beschützer aller lebenden Wesen genannt haben, von Buddha, dem Stifter der Religion, aber nur verächtlich als einem kleinen Zauberer gesprochen haben. In der Ausübung magischer Praktiken bestand daher auch im wesentlichen das Wirken des Padmasambhava in Tibet. Und das Ergebnis dieser Tätigkeit bestand darin, daß es dem seltsamen Manne mit unbestreitbar großem, wenn auch nicht restlosem Erfolg gelang, die Götter und Geister der Bon-Religion zu „bannen“; das heißt: die Reaktion des Bontums aufzufangen, indem er wesentliche und mit dem tibetischen Denken eng verbundene Züge der Bon-Religion synkretistisch mit dem Buddhismus verband. Die Lebensgeschichte des Padmasambhava ist von legendären Zügen umrankt. Sein Name verweist bereits darauf, Padmasambhava, tibetisch Padma´byun hnas, das bedeutet „der aus dem Lotos Geborene“. Die Legende berichtet, der künftige Heilige sei im Mündungsgebiet des Indus dem Blütenkelch einer Lotosblume in Gestalt eines achtjährigen Knaben entstiegen. Dann habe ihn der König Indrabhūti von Udāyna, der von diesem Wunder erfuhr, an Sohnes Statt angenommen. Als sich der König aus dem elterlichen Leben zurückzog, überließ er seinem Adoptivsohn die Herrschaft. Aber Padmasambhava verzichtete auf den Thron, um weite Reisen unternehmen zu können, auf denen er sich in die Geheimlehren vieler Meister der Magie einweihen ließ.
Das beliebteste Mittel zur Gewinnung übersinnlicher Erkenntnisse, von denen Padmasambhava zuerst an dem Ort Shītavana, „kalter Hain“, Gebrauch machte, war in der damaligen synkretistisch-magischen Welt des nordwestlichen Indien die Meditation an Leichenstätten.
Padmasambhava befand sich gerade auf einer Reise durch das westliche Tibet, als ihn die Einladung des Königs Khri-srong lde-btsan erreichte. Bald darauf zog der seltsame Heilige in Lhasa ein - hoch zu Roß, ein wildblickender Mann mit einem Zauberstab, eine Schädelschale bei sich führend, und begleitet von einer seiner Frauen und einem Gefolge von Magiern. Etwa im Jahre 770 gründete Padmasambhava ungefähr 80 Kilometer südöstlich von Lhasa das Kloster bSam-yas, das er zum Mittelpunkt seiner Wirksamkeit in Tibet machte. Dort versammelte er um sich Mönche, die nicht den strengen Regeln des zölibatären Lebens unterworfen waren, vielmehr heiraten durften. Äußerlich waren sie durch rote Kleidung und rote Kopfbedeckung gekennzeichnet, weshalb sie als „Rotmützen-Kleriker“ bekannt geworden sind.
Der Widerstand der Bon-po erlahmte, als sie von den nächtlichen Kultfeiern des Padmasambhava erfuhren, die ihren eigenen magischen Riten „überlegen“ waren. Padmasambhava veranstaltete sie mit Opfern von heißem Branntwein und Blut in Menschenschädeln, ließ dabei lange Zaubertexte rezitieren und handhabte magische Geräte wie Donnerkeil, Glöckchen, Zauberdolch, Schädeltrommel und Knochentrompete. Es ist nicht sicher, wie lange Padmasambhava in Tibet blieb - die Chronisten schwankten zwischen 50 Jahren und 18 Monaten -, trotzdem war sein Einfluß exorbitant und drängte das Zauberwesen der Bonreligion in den Hintergrund. Der Legende nach reiste er zur nepalesischen Grenze, erhob sich dort in die Lüfte und flog in das sagenhaften Land der Rāksha-Dämonen, um diese zum Buddhismus zu bekehren.
Tsong-kha-pa der Reformator
Padmasambhava war jedoch nicht die einzige Gestalt der tibetischen Religionsgeschichte, die die dem Geist jenes Landes eigentümliche und für die tibetische Form des Buddhismus charakteristischen Züge geprägt hat. In seinen geistlichen Intentionen durchaus verschieden von Padmasambhava, in seiner weiterwirkenden Bedeutung ihm aber keineswegs nachstehend war der große tibetische Reformator Tsong-kha-pa (der Mann aus dem Zwiebeltal, geb. 1357). Sein Wirken verglichen Religionswissenschaftler mit der abendländischen Reformbewegung von Cluny. Zwischen der Zeit Padmasambhavas und Tsong-kha-pas lagen Jahrhunderte des inneren und äußeren Verfalls des tibetischen Reiches. Der religiöse Antagonismus zwischen den Bon-po und den Buddhisten hatte zeitweise zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt. Es war eine Folgeerscheinung dieser Zeit der Wirren, daß sich die großen buddhistischen Klöster des Landes – entgegen der Lehre des Buddha - zu Zentren politischer Macht entwickelten. Das moralische Niveau in den Klöstern selbst war jedoch erschreckend tief, und wirkliche Religiosität wurde durch eine unumschränkt vorherrschende Magie ersetzt. In dieser Situation trat Tsong-kha-pa als Erneuerer der buddhistischen Lehre und als Reformator von Zucht und Ordnung des klösterlichen Lebens auf den Plan. Er hatte bereits im Alter von sieben Jahren das Novizengelübde abgelegt, sich in seiner Jugend mit größtem Eifer dem Studium des Buddhismus gewidmet und war bereits damals aus philosophischen Disputationen als Sieger hervorgegangen. Seine eigentliche Bedeutung aber liegt in der Reform der Ordenszucht. Er gründete 35 Kilometer östlich von Lhasa das erste Kloster seiner neuen reformatorischen Richtung, dem der Name dGa-ldan („das Freud-Erfüllte“) gegeben wurde. In diesem Kloster war der Genuß berauschender Getränke verboten, und die strikte Einhaltung des zölibatären Lebens der Kleriker war verpflichtend. Zu langes und unzeitgemäßes Schlafen sowie die Einnahme einer Abendmahlzeit waren untersagt usw. Die Reformsekte mit Namen dGe-lugs-pa (Tugendsekte) erfuhr schon damals einen großen Zustrom von Mönchen und konnte später die Führung des tibetischen Buddhismus übernehmen. Zur Unterscheidung von den schwarzen Mützen der Bon-po und den roten des älteren tibetischen Buddhismus trugen die Anhänger der Tugendsekte gelbe Kopfbedeckungen.
Die chubilghanische Sukzession
Kurz bevor der Reformator Tsong-kha-pa, auf den die „Gelbe Kirche“ zurückgeht, starb, prophezeite er seinen beiden vornehmsten Schülern mKhas-grub-rje und dGe-´dungrub-pa, sie würden sich als Oberpriester ständig neu verkörpern. Er begründete damit eine rein geistliche Übertragung priesterlicher Ämter, die der Gelben Kirche wesentlich dazu verholfen hat, die Herrschaft über Tibet zu erlangen. Bekannt geworden ist diese Form der Übertragung geistlicher Ämter unter dem Namen „chubilghanische Sukzession“, der sich ableitet von dem mongolischen Wort für „Verwandlung“, das chubilghan lautet. Nach der Lehre der chubilghanischen Sukzession gelten die Hierarchen Tibets als „Verwandlungen“, als immer neue Inkarnationen von Buddhas und Bodhisattvas (erleuchtete Himmelswesen). Dies betrifft in erster Linie die beiden Oberpriester des Lamaismus. Unter ihnen steht rangmäßig an erster Stelle die Inkarnation des „Buddha des unermeßlichen Lichtglanzes“ (Buddha Amitābha), die sich manifestiert im sogenannten Pan-chen-rin-po-che oder Panchen Lama (wörtlich: Juwel der Gelehrten). Inkarnation des Bodhisattva Avalokiteshvara, des „gnädig herabblickenden Herrn“, des speziellen Schutzheiligen Tibets, ist der Dalai Lama (wörtlich: Ozean des gelehrten Wissen). Die Anwendung der chubilghanischen Sukzessionslehre auf die Großlamen des tibetischen Buddhismus hat eine bestimmte Praxis ausgebildet, die zuletzt vom chinesischen Kaiser Kien-lung in Jahre 1794 geregelt wurde. Sie betrifft die Auffindung einer neuen Inkarnation nach dem Tode eines Oberpriesters. Man rechnet im allgemeinen damit, daß sich der verstorbene Geistliche innerhalb von 49 Tagen in einem neugeborenen Kind wiederverkörpert. Maßgeblich sind Hinweise des Verstorbenen zu Lebzeiten, Weissagungen des Staatsorakels sowie Körpermerkmale des Kindes und Wunder-erscheinungen, die sich zur Zeit seiner Geburt ereignet haben sowie Krankenheilungen durch das Kind. Eine Probe der Echtheit seiner Inkarnation muß das Kind schließlich damit ablegen, daß es aus einer Fülle ihm vorgehaltener Gegenstände nach solchen greift, die zum persönlichen Besitz des verstorbenen Großlama gehörten. Diese rein geistliche Genealogie der chubilghanischen Sukzession gilt ebenfalls für alle Äbte großer Klöster, hohe Würdenträger und geistige Führungspersönlichkeiten im Ausland, wie dem ranghöchsten mongolischen Lama, dem Chutuktu von Ulān Bātor. Den Tibetern galten seit Katharina der Großen sogar alle russischen Zaren als buddhistische Inkarnationen.
Die Dalai Lamas
Die hierarchische Struktur des tibetischen Staates mit dem Dalai Lama als politische Spitze wurde vollendet unter dem fünften Dalai Lama ngag-dbang blo-bzang (1617-1682), einem der größten Kirchenfürsten Tibets. Er war auch der Erbauer des Potala, des auf dem roten Hügel bei Lhasa errichteten Regierungspalastes. Unter seinem Nachfolger Blo-bzang ri-chen tshangs-dbyangs rgya-mtsho (1683-1706) scheinen Kreise, die den Lehren Pamasambhavas - also den Rotmützen - nahestanden, noch einmal Einfluß ausgeübt zu haben. Nur so kann man sich sein ausschweifendes Leben mit seinen vielen Freundinnen und regelmäßigen orgiastischen Zechgelagen erklären. Die Dalai Lamas der neunten bis zwölften Inkarnation erreichten durchweg nicht das Alter der Volljährigkeit. In einigen Fällen ist sicher, daß sie vorher ermordet wurden. Erst der dreizehnte Dalai Lama Ngag-dbang blo-bzang thub-ldan rgya-mtsho entging diesem Schicksal. Ihm kam das Verdienst zu, seinem Land im Streit rivalisierender Großmächte die Unabhängigkeit erhalten zu haben. Der 1935 geborene und 1950 inthronisierte vierzehnte Dalai Lama Ngag-dbang blo-bzang bstan dzin rgya-mtsho floh vor der 1950 eingeleiteten chinesischen Okkupation Tibets im März 1959 nach Indien. Dort richtete er, inmitten einer großen Menge von tibetischen Flüchtlingen, eine Exilregierung ein. Die kommunistischen Besetzer zerstörten in Tibet nahezu alle Klöster und Kultstätten und verboten lamaistische Praktiken. Viele Gläubige, allen voran Nonnen und Mönche, wurden gefoltert und fanden aufgrund ihrer Glaubensüberzeugung den Tod. Trotz einer allmählichen Lockerung des Verbots der Religionsausübung werden in Tibet auch heute noch die Menschenrechte, zu denen auch das Recht auf freie Religionsausübung gehört, mißachtet. Aufgrund der starken Medienpräsenz des Dalai Lama sind heute auch westliche Menschen mit den bedauerlichen Zuständen in Tibet vertraut.
André Golob
Weiterführender Buchtip zu den
spirituellen und inhaltlichen Lehren
des Lamaismus´: Sangharakshita,
Einführung in den tibetischen
Buddhismus, Herder spectrum,
Freiburg i.B. 2000, 8,40 €
ISBN 3-451-04731-4 |
|
| Nach oben |
|
 |
André Golob

Anmeldedatum: 21.10.2006
Beiträge: 129
Wohnort (nur bei Vollmitgliedschaft erforderlich ): 46236 Bottrop
|
 Verfasst am: 13.09.2007, 01:22 Titel: Verfasst am: 13.09.2007, 01:22 Titel: |
 |
|
| an aa |
|
| Nach oben |
|
 |
|
|
Sie können keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Sie können auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Sie können an Umfragen in diesem Forum nicht teilnehmen.
|

443 Angriffe abgewehrt
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Deutsche Übersetzung von phpBB.de |